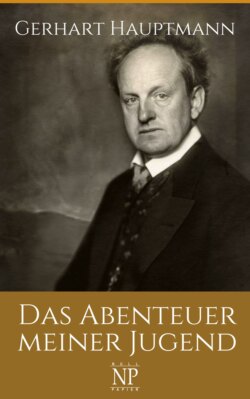Читать книгу Das Abenteuer meiner Jugend - Gerhart Hauptmann - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fünfundzwanzigstes Kapitel
ОглавлениеDie Saison war im Gang, das Hotel zur Krone, wie immer um diese Zeit, glich einem Bienenhaus. Ankommende Gäste, Kutscher und allerlei Leute lärmten im Hof.
»Hauffe, sullst assa kumma!« schrie die kleine, jetzt siebenjährige Ida Krause mit durchdringender Stimme täglich um zwölf Uhr vom Haus hinüber zu den Stallungen. Den derben, kleinen, resoluten Strunk hatte man gern, und mein Vater freute sich jedes Mal, wenn er Idas »Hauffe, sullst assa kumma!« vernahm. Sagte man ihm, dass er ihr das Geschrei verbieten sollte, lehnte mein Vater lachend ab.
Plötzlich, nachdem ich sie tags zuvor noch ihren pflichtgetreuen Ruf hatte ausstoßen hören, wurde bekannt, Ida Krause sei tot. Sie war an Diphtheritis gestorben.
Der Ruf also, der den alten Pferdeknecht Hauffe zu jenem Mittagessen aufforderte, das ich selbst einmal als Gast am Krausetisch unvergesslichen Angedenkens eingenommen hatte, erscholl von nun an in Ewigkeit nicht mehr. Ein scheinbar unsterbliches Etwas, ein tüchtiges, bei all seiner Jugend bereits arbeitswütiges Bauernmädel hatte sich ins Nichts aufgelöst. Ich habe weder die Leiche gesehen, noch habe ich den kleinen Sarg begleitet, als man Ida unter Vorantritt der Schule und des Lehrers Brendel vom Oberdorf nach dem Niederdorf, parallel dem Flusse der Salzbach, zu Grabe trug.
Dieser Tod, unzeitig bis zum Widersinn, gab mir zwar immer wieder zu denken, nahm mir jedoch selber nichts von meiner knabenhaften Lebenssicherheit.
*
Ich weiß nicht, wie ein neuer Brunneninspektor namens Manser zu seinem Posten gekommen und Nachfolger meines Großvaters geworden ist. Er hatte den Krieg als Feldwebel mitgemacht und war mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse für besondere Verdienste belohnt worden. Ein barscher und militärischer Ton machte ihn anfangs unbeliebt. Er unterlag hierin der Zeitmode. Auch mit meinem Vater geriet er deswegen sehr bald in Kollision. »Ich verbitte mir diesen Unteroffizierston!« waren die Worte, mit denen mein Vater eines Tages den Verkehr zwischen sich und dem neuen Manne geregelt hatte. Ob es ihn wohl milder stimmte und ob er überhaupt daran dachte, dass die Karriere seines verstorbenen Vaters, wie die Mansers im Siebziger Krieg, in den Freiheitskriegen ihre Wurzel hatte, aus denen er ebenfalls als Feldwebel und mit Auszeichnung hervorgegangen war?
Ich erinnere mich eines Vorgangs auf der Promenade, der eine Seite des neuen Geistes besonders sichtbar machte. Schon früher waren in Salzbrunn Tiroler aufgetaucht, durch die grüne, kniefreie Tracht und derbes genageltes Schuhwerk kenntlich. Einer von ihnen hatte sogar eine lebende Gemse mitgebracht. Er schob sie in einer Kiste, über die ihr Rücken und Kopf nur eben hinausragte, auf seinem Karren von Ort zu Ort: »Willst du nicht das Lämmlein hüten?« Die Ballade Friedrich Schillers vom Gemsenjäger steckte mir bereits im Kopf:
… Plötzlich aus der Felsenspalte
tritt der Geist, der Bergesalte.
Und mit seinen Götterhänden
schützt er das gequälte Tier.
›Musst du Tod und Jammer senden‹,
ruft er, ›bis herauf zu mir?
Raum für alle hat die Erde –
was verfolgst du meine Herde?‹
Man mag ermessen, welchen Eindruck mir nun die Gegenwart einer wirklichen Gemse hätte machen sollen. Aber eigentlich war ich ein wenig enttäuscht, denn das friedliche Tierchen, das sich durchaus und durchum, aber besonders durch seine Hörnchen, als wirkliche Gemse erweisen konnte, stellte sich doch auch als naher Verwandter unsrer gewöhnlichen Ziege heraus, nur schien es mir gütiger, reiner, herzlicher. Dass es sich, gewohnt an den Glanz und die Freiheit alpiner Schneegipfel, in seiner Kiste wohlfühlte, glaubte ich nicht, obgleich es sich für gereichte Grasbüschel und Blätter dankbar erzeigte.
Ein anderer Tiroler, zwar ohne Gemse, erschien auf der überfüllten Promenade eines Julinachmittags. Die Kurkapelle musizierte mit besonderer Verve in ihrem Pavillon. Mein Onkel Hermann, der Badearzt, im grauen Gehrock und grauen Zylinder, sowie seine Kollegen, Doktor Valentiner und Sanitätsrat Biefel, nicht minder elegant, lagen wie immer vor dem Portal des Brunnenhauses peripatetisch1 ihrer Praxis ob. Schwindsüchtige und Gesunde promenierten durcheinander, jeder das Glas mit kaltem oder gewärmtem Brunnen oder einem Gemisch von Eselsmolken und Brunnen in der Hand.
Der sauber und stilecht kostümierte Tiroler war ein schöner, zwischen sechzig und siebzig stehender alter Mann mit kraftvoll gebräunten Knien und prächtigen Schultern. Sein gewaltiger Schnurrbart, der kein dunkles Haar zeigte, war wohlgewachsen und wohlgewichst, sein dichtes, schneeweißes Haupthaar desgleichen. Wie eine glänzende, bürstenartige Kappe stand es um seinen Kopf.
Das Wohlgefallen war groß, wo immer dies Musterexemplar eines Steiermärkers, Kärntners oder Pinzgauers vorüberkam. Man wurde dann allgemein auf ihn aufmerksam, als er sich vor dem Musiktempel unter den Augen der Kurkapelle und ihres Dirigenten zu tun machte.
Seine Vorkehrungen, die ich wie alle, die sie sahen, mit einer Art heiteren Spannung verfolgte, zeigten eine gewissermaßen humoristische Seltsamkeit. Er rückte zunächst eine kleine, quadratische, frisch gehobelte Kiste im Gartenkies zurecht, die er mit einem roten Tuch überdeckte. Es löste allgemeines Gelächter aus, als er mit seinen Nagelschuhen diesen farbigen Sockel betrat und krachend eindrückte.
Der kernige Mann ging nun ohne sein Piedestal2 dazu über, die Darbietung der Kurkapelle mit schrillem Vogelgeschmetter zu begleiten, was, wäre es nicht so rührend naiv gewesen, ohne Zweifel ein Unfug war. Als er seine Kunst eine Weile zum Ergötzen der Promenade ausgeübt hatte, sah man drei Brunnenschöpfer in schlesischer Bauerntracht, mit langen Schaftstiefeln an den Füßen, durch das bunte Gewühle schwer herantrapsen. Das Trio packte den weißhaarigen Mann, nahm ihn, nolens volens, teils am Kragen, teils bei den Händen und führte ihn trotz seinem Widerstande, seinem eigenen Proteste und dem der Kurgäste in das Kellergefängnis des Polizeigewahrsams ab. Manser, der neue Brunneninspektor, hatte, seine Kompetenz überschreitend, diese sinnlose Arretierung verfügt.
Die Empörung war allgemein. Wochenlang müssen dem neuen Manne die Ohren von keineswegs schmeichelhaften Urteilen über die Brutalität seines widersinnig-antideutschen Eingriffs geklungen haben.
Meine Schwester Johanna war aus der Pension zurückgekehrt, zu einem schönen Mädchen herangewachsen und ein wahres Musterbeispiel von Wohlerzogenheit. Sie wohnte in einem Zimmerchen des Hotels, hielt sich aber tagsüber meist im Kurländischen Hof, dem Hause des Fräuleins von Randow, auf, deren Pflegetochter, Fräulein Jaschke, eine geprüfte Lehrerin, ihr Unterricht im Französischen gab und überhaupt ihre Erziehung fortsetzte.
Wie Johanna jetzt mit Messer und Gabel bei Tisch verfuhr, erregte mir staunende Bewunderung. Die englische Art und Weise zu essen, bei der man um nichts in der Welt das Messer zwischen die Lippen bringen durfte, war damals aufgekommen. Selbstverständlich, dass Johanna geschmackvoll gekleidet war und dass ihr gesamtes Auftreten nunmehr dem einer Tochter aus gutem Hause entsprach. So war ich überaus stolz auf sie, obgleich ich mich zu ähnlich abgezirkelten Formen, was mich selbst betraf, keineswegs verstehen konnte.
Wenn ich mich mit meiner schönen Schwester damals in den Promenaden zeigen konnte, fand sich dagegen mein Familienstolz aufs höchste befriedigt.
Beständig schien sie Geburtstag zu haben, wenn man die Huldigungen durch Konfekt und Blumen berücksichtigte, mit denen tagaus, tagein ihr Zimmer bedacht wurde.
Ein besonderer Verehrer Johannas war der alte Ostelbier3 Huhn, derselbe, der mir einmal das Danaergeschenk des Rollwagens mit vier Pferden in einem Verkaufsstand der Elisenhalle aufgedrängt hatte. Auch Gustav Hauptmann, wie selbstverständlich, huldigte ihr. Es war nicht das erste Mal, dass einer hübschen Nichte gegenüber der Onkel in den Courmacher überging.
Durch Johannas Erfolge wurde damals Tante Elisabeth Straehler, eine der nun verwaisten Schwestern vom Dachrödenshof, aus ihrem Versteck hervorgelockt. Dass sie bereits zweiunddreißig zählte, die Nichte Johanna aber kaum siebzehn, konnte sie dieser schwer vergeben. Noch ist mir ihr Antlitz erinnerlich, dessen Nase und Mund eine gewisse Scheelsucht nicht verbergen konnten, wenn sie Johannas ansichtig ward. Da trug meine Schwester etwa ein zu kurzes Kleid, oder es war zu tief ausgeschnitten. Sie nannte es auch einen Skandal, wenn es sich durch lebhafte Farben und hübschen Schnitt auszeichnete, und stand nicht an, auf gewisse provokante Damen der Straße dabei anzuspielen. Ihr Mundwerk brachte es manchmal so weit, dass sich Hannchens Zorn in wütenden Tränen austobte.
*
Die Reste des Geistes vom Dachrödenshof standen nicht mehr im Zentrum des Orts, sondern waren gleichsam irgendwo ins Dunkel der Peripherie gerückt, besonders seit Manser erschienen war und eine angeblich ziemlich pomphafte Residenz in den langen Dienstgebäuden hinter dem Brunnenhof errichtet hatte. Für das bucklige Täntchen Auguste gilt dies indessen nur bedingt. Fromm und resigniert wie sie immer war, wurde sie nur durch das bittere Aufbäumen ihrer Schwester gegen die veränderten Umstände aufgestört und in deren seelische Miseren wieder und wieder gegen ihre Neigung hineingezogen. Gemeinsam freilich war beiden Schwestern die entschiedene Absage an die neue Zeit, die sie durchaus nicht verstehen konnten, nur dass Tante Auguste sich nicht erst jetzt von der Welt abzuwenden brauchte, da sie schon seit langem ihr Genügen in der Bibel, in Thomas a Kempis, in frommen Poesien und Musik gesucht und gefunden hatte.
*
Um jene Zeit schloss ich mich auf eine fast seltsame Weise an meine Schwester an. Liebte ich sie? War es Eifersucht? Ich maßte mir jedenfalls an, sie auf mancherlei Weise zu tyrannisieren.
Ich hatte Freude an jedem heimlichen Schabernack. Hatte meine Schwester sich in den heißen Nachmittagsstunden, um zu schreiben, zu lesen oder zu ruhen, in ihr Zimmer zurückgezogen und eingeschlossen, was bei dem Gasthofbetrieb nur natürlich war, so schlich ich heran, klopfte bescheiden an die Tür und war, wenn Johanna öffnete, nicht zu sehen. Ich wiederholte diesen Streich mehrmals am Nachmittag und wurde von ihr niemals entdeckt. Blieb begreiflicherweise das bescheidene Klopfen mit der Zeit wirkungslos, so führte ich Faustschläge gegen die Tür, ein Unfug, den meine Schwester nicht überhören konnte.
*
Die Verkaufsstände des Badeortes reizten um diese Zeit mehr und mehr meine Begehrlichkeit. Bald war es ein Bergkristall, eine weiße oder rote Koralle, ein Achatschälchen, das ich besitzen wollte, ein großer oder kleiner Gummiball. Einmal war ich versessen auf ein braunes ledernes Portemonnaie, das die Sonne eigenartig gebleicht hatte. Es übte eine beinahe krankhafte Anziehungskraft auf mich aus. Ich hatte mir pfennigweise, ich weiß nicht wo, Geld zusammengeschnorrt, sodass ich nahezu Dreiviertel des Preises beisammen hatte. Mit der wachsenden Summe war ich wieder und wieder zum Tische des fliegenden Händlers zurückgekehrt, aber er ließ sich durchaus nichts abmarkten. Bis zur Verzweiflung ausgehöhlt von der durch dieses Portemonnaie und seine Patina erregten Zwangsidee, pochte ich an Johannas Zimmer. Ich pochte und tobte, bis sie öffnete. Aber ich traf sie ebenso unerbittlich hart, wie der unerbittlich harte Verkäufer war.
Wenn ich von dieser kleinen Geschichte absehe, so muss ich gestehen, ich habe vielfach nur aus Freude am Ärgern meine Schwester gequält. Schwer zu sagen, welch ein letztes Gefühl von Unbefriedigtsein zugrunde lag. Vielleicht war irgendein dumpfes Hadern mit einem unverstandenen Geschick die Ursache, auf Grund eines rastlosen Unbehagens, das mich damals wohl gelegentlich überkommen hat, einer Empfindung von Sinnlosigkeit meiner Existenz. Ein hässlicher Dämon, viel ärger als Puck, hatte mich in Besitz genommen.
*
Was für ein Neues wollte damals in mir aufstehen und wühlte in mir? Habe ich mich vielleicht im Spiegel der Schönheit erblickt und missbilligt? Am Ende wollte sich damals das Ende meiner unbewussten Kindhaftigkeit leise ankündigen, aber: »Suche nicht alles zu verstehen, damit dir nicht alles unverständlich bleibe«, sagt ein Philosoph. Und so lasse ich denn den Umstand auf sich beruhen, der das Rohe in mir gegen das Veredelte, das Wilde gegen das Gesetzte, das Thersiteshafte gegen das Gute, das Hässliche gegen das Schöne aufzurufen schien.
Vielleicht sah meine Schwester in meinem Verhalten mit Besorgnis Zeichen der Verwahrlosung und hatte sich mit ihrer Lehrerin Mathilde Jaschke darüber ausgesprochen. Sie nahm mich jedenfalls eines Tages zu dieser Dame und deren Pflegemutter, dem Fräulein von Randow, mit.
Beide Persönlichkeiten neigten sich mit einer großen Zartheit und Wärme zu mir. Ich durfte Tee trinken, Kuchen essen und mich in den Räumen des Hauses, genannt Kurländischer Hof, nach Belieben umsehen. Wohlfühlen konnte sich hier ein zügelloses Naturkind zunächst freilich nicht, aber es überkam mich ein heimliches Staunen, eine stille Bewunderung. Die Zimmer mit ihren antiken Möbelstücken und ihren Parkettfußböden rochen nach poliertem Holz und nach Bohnerwachs und waren mit Reseda und Goldlack in Vasen und Schalen parfümiert.
Fräulein von Randow war wohlhabend. Ich habe die hohe, würdevolle Erscheinung mit der weißen Rüschenhaube und dem schlichten grauen Habit deutlich in Erinnerung. In ihrem Besitz befand sich eine alte Vitrine, die von vier Mohren getragen wurde. Ein anderer Schrank mit vielen kleinen Schüben war mit Olivenholz fourniert und das Äußere jedes Faches mit sogenanntem Landschaftsmarmor ausgelegt. Jedes der beiden Stücke war eine Seltenheit. Aber auch alles übrige der gesamten Einrichtung war kostbar und von erlesenem Geschmack. Das Ganze, als es später durch Erbschaft an Mathilde Jaschke, hernach auf meine Schwester überging, blieb jahrzehntelang eine Fundgrube und ist trotz mancher Verkäufe und Schenkungen bis zum heutigen Tag noch nicht erschöpft.
Die selbstverständliche Freiheit und Sicherheit, mit der meine Schwester sich im Hause der adligen Dame bewegte und wie sie hier gleichsam als dazugehörig betrachtet wurde, steigerte meinen Respekt vor ihr. Und in der Tat hatte schon damals das Verhältnis des weißgelockten Fräuleins von Randow zu ihr einen mütterlichen Charakter angenommen. Ähnlich stand es mit Fräulein Jaschke, der Pflegetochter.
Ein resoluter Geist und ein goldenes Herz waren vereinigt in ihr, Eigenschaften, womit sie sich überall durchsetzte.
»Das größte Zartgefühl schulden wir dem Knaben«, sagt Juvenal. Es war auch der Grundsatz, nach dem ich im Kurländischen Hof behandelt wurde. Hier erschloss sich mir ahnungsweise ein bis dahin unbekanntes Bildungsgebiet, wenn es mich vorerst auch nur sehr gelegentlich und sehr flüchtig berühren mochte. Eine gewisse Verwandtschaft bestand allerdings zwischen diesem Hause und Dachrödenshof als den letzten Ausläufern einer Kultur, die im großen ganzen versunken war.
*
In der Umgebung des Fräuleins von Randow herrschte der Geist heiter-ernster Weltlichkeit, der keine moralische Schärfe zeigte und es einem ganz anders als in der scharfen Atmosphäre um das bucklig-fromme Täntchen Auguste wohlwerden ließ, deren spitze Blicke und spitzere Worte fortwährend Kritik übten. Welche der beiden Geistessphären an sich tiefer und bedeutsamer war, entscheide ich nicht.
Es war der Kummer meiner Mutter, dass mein Vater zu seiner Tochter Johanna, solange sie Kind war, kein freundliches Verhältnis gewinnen konnte. Er schien sie immer zurückzusetzen. Es war nicht zu ergründen, ob dies nun nach Hannchens gleichsam triumphaler Rückkehr aus der Pension anders geworden war. Immerhin schien sich mein Vater zurückzuhalten, und wahrscheinlich hatte meine Schwester im Kurländischen Hof mit der imponierenden adligen Dame und ihrer resoluten und gebildeten Pflegetochter einen neuen und starken Rückhalt gefunden.
Dieser Rückhalt verstärkte sich.
Er führte alsbald im Dachrödenshof und sogar bei meiner Mutter zu Eifersucht.
Tante Auguste und Fräulein Jaschke hatten einander nichts zu sagen und mieden sich. Elisabeth stand Fräulein Jaschke näher, da sie immer noch Hoffnungen weltlicher Art nährte, aber das Verhältnis war kriegerisch. Nie ist zwischen beiden das Kriegsbeil vergraben worden. Meistens war es die Seele Johannas, um die man auf beiden Seiten stritt, Elisabeth im zelotischen Sinn, Mathilde ihren Zögling verteidigend.
1 auf der Lehre des Aristoteles beruhend <<<
2 Piedestal = (meist aufwendig gestalteter) Sockel <<<
3 Großgrundbesitzer und Junker <<<