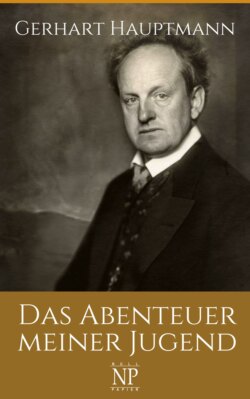Читать книгу Das Abenteuer meiner Jugend - Gerhart Hauptmann - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neunzehntes Kapitel
ОглавлениеIm grellen und peinlichen Lichte dieser Tage erklärte sich mir ein Besuch im vergangenen Jahr, der mich damals eitel Freude und Wonne dünkte. Ein reizendes Mädchen, Toni, siebzehnjährig, Halbschwester meines Vaters und Schwester Onkel Gustavs, der im Hause war, tauchte plötzlich bei uns auf, sie und ihre ältere Schwester. Sie hatte ein großes Glück gemacht, wie es hieß, da ein reicher Industrieller aus Remscheid um sie geworben und ihr Jawort erhalten hatte. Ich war sogleich in Toni verliebt und genoss eine Menge Zärtlichkeiten von ihr, wie sie ein übermütiges und glückberauschtes Kind an einen Siebenjährigen ohne Gefahr verschwenden kann. Als nach einigen Tagen der Bräutigam erschien, war die Stimmung gedämpfter geworden. Und kurz und gut, Mijnheer Soundso – er trug sich wie ein Holländer –, ein Eisen- und Stahlwarenfabrikant, hatte beschlossen, den Vermögensanteil seiner Braut und im Auftrag den der anderen Halbschwestern um jeden Preis aus dem Gasthof herauszuziehen, und ließ sich durchaus nicht davon abbringen.
In diesem Besuch wirkten sich die Folgen der späten Heirat meines Großvaters Hauptmann aus, und mit ihm begann der stille Verzweiflungskampf meines Vaters, der den Verlust unsres Gasthofs und unseres Vermögens schließlich und endlich nicht abwenden konnte.
Gustav Hauptmann blieb im Haus, nie aber hat mein Vater eine seiner Halbschwestern von jener Zeit an wiedergesehen. Als die verwitwete Toni mit ihrem Sohn fast dreißig Jahre darauf vor der Tür seiner kleinen Villa in Warmbrunn stand, wurde sie nicht hereingelassen.
*
Beim Tode meines Großvaters müssen meinem Vater die geschäftlichen Schwierigkeiten beinahe über den Kopf gewachsen sein. Es war ihm anscheinend noch nicht gelungen, die Hypotheken aufzutreiben, durch die er die Auszahlung seiner Halbgeschwister ermöglichen konnte. Sie alle drei, das heißt ihre Männer, bestanden auf ihrem Schein. Wir ahnten nicht, und auch meine Mutter ahnte wohl nicht, wie es um uns stand, als sie sich darüber aufregte, dass Vater ihr nicht genügend Vertrauen schenke. Wenn er die zum Ausgleich und zur Rettung nötigen Hypotheken nicht auftreiben konnte, so lagen wir mitten im Winter auf der Straße, und es brach ein Elend ohne Maß über uns herein. Er hatte recht, wenn er das verschwieg.
Der Brunneninspektor hatte bei der Verteilung seines nicht kleinen Barvermögens fast ausschließlich seine zwei unverheirateten Töchter, Elisabeth und Auguste, bedacht. Kein Wunder, dass der Gatte meiner Mutter Marie, dessen Schiff im Sturm auf Leben und Tod kämpfte, in einen Zustand geriet, in dem sich Erbitterung und Verzweiflung mischten, da ja eine gerechte Verteilung die Rettung seines Schiffes bewirkt hätte.
Nun, mein Vater rettete diesmal noch selbst sein Schiff. Und dass dies geschah und wir von da ab noch fast ein Jahrzehnt an Bord bleiben durften, war für die Entwicklung unsrer Familie von nicht zu überschätzender Wichtigkeit.
*
Was ich von allen diesen Verhältnissen mehr ahnungsweise als wirklich wissend aufnahm, veränderte die äußeren Formen meines Betragens und meines Lebens nicht. Die neuen Beschwerungen konnten der Leichtigkeit und dem Schwunge meiner Bewegungen nichts anhaben. Ich habe erzählt, wie ich trotz allem und allem auf dem Karren voll goldenen Laubs im Posthof meine Jungens kutschierte, und zwar in vollendet heiterem Übermut, trotzdem mir der Stachel, dass ich dem Tode nicht entgehen könne, im Gemüte saß. Auch das neue Erlebnis, konnte ich es gleich nie endgültig abschütteln, trat während langer Zeiten, von neuesten Eindrücken überdeckt, in das Unterbewusstsein zurück.
Die Hilfe, die mein Vater um Neujahr erhalten haben musste, brachte ihm also Beruhigung; unser Leben konnte in alter Weise fortgehen. Die nationalen Vorgänge aber waren so unwiderstehlich aufschwunghaft, dass sich ihr Geist allem, auch unserm Vater, mitteilte. Am 18. Januar unvergesslichen Angedenkens wurde im Schloss zu Versailles König Wilhelm von Preußen zum Kaiser gekrönt.
Bismarck und Moltke, Moltke und Bismarck waren in aller Munde. In der Schule sangen wir »Die Wacht am Rhein«, der alte Brendel selbst war festlich erregt. Die Hornhaut an den Kniebeln seiner Finger, die den Takt auf der Bank klopften, wurde immer dicker. Er holte sogar in jeder Gesangsstunde seine Schulmeistergeige hervor, was er früher nie getan hatte. Sozusagen mit Ächzen und Krächzen verjüngte er sich. Zwar noch immer fielen die Worte: »Ihr Bösewichter! Du Bösewicht!«, aber dann hörte man ihn auch wohl hinausseufzen: »Kinder, es ist eine große, gewaltige Zeit!« – »Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall!« sangen wir auf der Straße. Und überhaupt schwelgten wir Jungens in nationaler Begeisterung. Einen Spielkameraden hatten wir schon zu Anfang des Krieges rücksichtslos als Franzosen verfolgt, weil er mit einer Stürmermütze erschienen war, die an die Kopfbedeckung der Rothosen erinnerte. Wir kannten ihn und die Eltern des Jungen genau, wussten, dass es ein ebenso guter Deutscher war wie wir anderen. Wir stießen ihn trotzdem einstimmig aus und verfolgten ihn, wo er auftauchte.
*
Die Tatkraft meines Vaters setzte nicht aus. Er war irgendwo mit Roon, dem Kriegsminister, in Verbindung gekommen. Der General hatte zu ihm gesagt: »Wenden Sie sich an mich, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen einmal in irgendeiner Sache dienen könnte!« Das hatte mein Vater nun getan. Ober-Salzbrunn, hat er ihm geschrieben, ist ein hübscher und leistungsfähiger Badeort und besonders geeignet, Gefangene unterzubringen, Rekonvaleszenten oder Gesunde. Das Eintreffen eines Franzosentransportes wurde daraufhin vom Kriegsministerium meinem Vater für Februar angesagt.
Leider wurde nicht Wort gehalten. Mitten in Winter hob sich in den Logierhäusern ein Kehren, Waschen und Putzen an, das gleichsam die Zeit auf den Kopf stellte. Nachdem sich dies alles als überflüssig herausstellte und die Hoffnung auf Staatsvergütung und mancherlei sonstige Sensation zu Wasser geworden war, fiel der ganze Ort über meinen Vater her, als den, der das Unheil verursacht habe.
Trotz des Einspruchs meiner Mutter wurde im Hause wieder melioriert. Primitive Wasserspülungen wurden angelegt, ferner eine Luftheizung im Kleinen Saal. Im Orte wuchs der Mut und die Lust zur Geselligkeit, und mein Vater dachte daran, den Kleinen Saal auch im Winter für Kränzchen, Bälle, Hochzeiten der Eingesessenen auszunützen. Der die Luft erwärmende Ofen stand in der Kutscherstube Unterm Saal, und ich hatte immer schon als Knabe den Verdacht, dass die Luft, die ebenfalls von Unterm Saal durch den Schacht in die Höhe stieg, nicht die beste sein könne.
*
Um Ostern war wieder ein Familientag, der sich, wie alle Feste in jener Zeit, zu einer Art Siegesfeier gestaltete. Onkel und Tanten, die wieder im Blauen und Großen Saal durcheinanderwimmelten, musizierend, schwatzend, lachend und patriotische Reden haltend, während wiederum draußen die Stare pfiffen, waren berauscht ohne Wein: aber dann tat auch er noch das Seine.
Bismarck, Bismarck, Bismarck war das Losungswort. Am 21. März war in Berlin der erste deutsche Reichstag eröffnet worden, wobei Bismarck den Fürstentitel erhielt. Er war der Schmied, er hatte auf seinem Amboss Pinkepank die deutsche Einheit zusammengeschweißt. Er war der Heros, er hatte die Kaiserkrone geschmiedet und König Wilhelm in die schon ergrauten Locken gedrückt.
Der Wein meines Vaters machte die Zungen der Onkels freigebig. Sie schworen, er habe mit Otto von Bismarck eine überraschende, frappante Ähnlichkeit. Vielleicht war etwas Wahres dran, besonders wenn man den gleichen Schnurrbart berücksichtigte. Nach seiner ganzen Art interessierte sich mein Vater gar nicht für eine solche Ähnlichkeit. Man stieß aber trotzdem begeistert auf ihn, gleichsam den Bismarck von Salzbrunn, an und ließ ihn mehrere Male hochleben.
Er war kein Spielverderber und nahm es hin.
Die Bismarckverehrung meines Vaters selbst war rückhaltlos, hatte er doch seine eigenen, vielfach zurückgestellten und verborgen gehaltenen Ideale von 1848 verwirklicht. Es lag aber auch ein Sieg des Gasthofs zur Preußischen Krone über den Dachrödenshof darin, der, inbegriffen den Oberamtmann Gustav Schubert auf Lohnig, die neue Zeit nicht von Herzen begrüßen konnte. Hie Bismarck, Deutsches Reich und deutscher Reichstag obendrein, dort Enge, Partikularismus, Konservativismus, kurz Dachrödenshof. In Bismarcks Größe und Erfolg lag meines Vaters Erfolg, Sieg und Rechtfertigung.
*
Der Frühling kam, und er wurde es in einem noch ganz anderen Sinne als bisher. Die Nation war auf einmal da, die bis dahin trotz Krieg und Kriegsgeschrei keine wesentliche Substanz hatte. Ich selber wäre wohl noch zu jung gewesen, um national zu sein, aber auch Erwachsene zogen vor, dieses Gefühl, sofern es großdeutsch oder alldeutsch war, für sich zu behalten. Mit einem Male brach es nun aus und hervor und wurde zum frischtönenden, lebenspendenden Element, drin wir alle schwammen.
Für Deutschland hatte die Kaiserkrönung in Versailles den Wert eines Schöpfungsakts. Es kam über unser Volk ein Bewusstsein von sich selbst. Es hatte sich selbst sich selber bewiesen, denn es hatte eine Reihe großer Männer, mit Bismarck an der Spitze, hervorgebracht, auf denen die Augen der Welt mit Staunen und Grauen, vor allem jedoch mit Bewunderung ruhten. Der Stolz auf sie, auf ihre Siege, die Siege des Volkes, teilte sich jedem, auch mir kleinem Jungen, mit, und ich stand nicht an, meinem Blute einen Anteil, ein Mitverdienst an solchen Erfolgen zuzuschreiben. Es hatte das durchaus nichts mit dem Zupfen der Scharpie1 zu tun, eines Verbandstoffes für die Verwundeten, das ich unter der Aufsicht meiner Mutter in Gemeinschaft der sonstigen Hausgenossen geübt hatte.
Jedermann ahnte die nun kommende, ungeheure deutsche Aufschwungzeit, wenn er auch das Gnadengeschenk des kommenden, mehr als vierzigjährigen Friedens nicht voraussehen konnte.
Die Schweizerei mit ihren Wiesen und ihren Himmelsschlüsseln hatte ein ganz anderes Gesicht. Sie bestand aus einem Holzhaus im Berner oder Schwarzwälder Stil mit hölzernen Umgängen und dazugehörigem Weideland. Die Schafferin, eine saubere Frau, die der Fürst, wie gesagt, hineingesetzt hatte, war fröhlich aufgeregt, als wir eines Tages bei ihr einkehrten.
Mich traf auf dem Rückwege von dort ein Missgeschick, dessen Narbe ich noch am Finger trage, das aber nicht meinen Himmel verdüsterte.
Mein Bruder Carl rief einen kleinen Hund, den wir freigelassen hatten und dessen Leine mir überantwortet war, und er kam, zurückgeblieben, an mir vorbeigerast. Da warf ich ihm seine Leine über. Diese Dummheit, womit ich unbedacht das Tier fangen und aufhalten wollte, jagte mir den Karabiner, den Haken der Leine, in den rechten Zeigefinger hinein.
Den Karabiner aus dem Finger zu lösen war nicht leicht, und man sagte mir, dass ich immer wieder von den Fingergedärmeln gesprochen hätte, die herausquöllen. Es war auf dem Rückweg, und so mussten wir wieder zur Schweizerei zurückkehren.
Mein Instinkt, was die Wundbehandlung betraf, beriet mich gut. Ich habe wohl eine Stunde lang den Finger am Trog der Schweizerei unter den Strahl des immer fließenden Bergwassers gehalten. Von der hilfreichen Schafferin dann verbunden, ist er in wenigen Tagen zugeheilt.
Am Annenturm blühten wie immer die Leberblümchen. Wenn schon im Frühling alles Tote lebendig wird, diesmal zeigte sich all dieses Leben noch festlicher. Die Gartenarbeiter in den Anlagen riefen einander laute Scherze zu, die Gartenweiber mit ihren Karren und Besen desgleichen. Die Brunnenschöpfer mit ihren Bässen und Tenören dudelten »Die Wacht am Rhein« und andere Kriegslieder vor sich hin, wenn sie mit großen Gläsern an langen Stangen den Heilquell aus der Tiefe der granitenen Brunnenumfassung heraufholten. Kutschke mit seinem »Was kraucht dort in dem Busch herum, ich glaub’, es ist Napolium!« war eine allbeliebte Figur. Und Benedetti, des Kaisers Gesandter an König Wilhelm in Ems, nicht minder:
Da trat in sein Kabinette
eines Morgens Benedette,
den gesandt Napoleon.
Der fing zornig an zu kollern,
weil ein Prinz von Hohenzollern
sollt’ auf Spaniens Königsthron.
Aus diesen heiteren Elaboraten des Krieges schwirrten Zitate überall umher, im Sprachschatz der Menschen heimisch geworden.
Man war bei allergrößtem Humor und wusste kaum, wo man ihn lassen sollte.
1 Verbandsmaterial aus Leinwand <<<