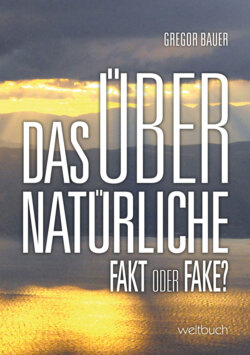Читать книгу Das Übernatürliche - Gregor Bauer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Warum habe ich dieses Buch geschrieben?
ОглавлениеAls ich ein Kind war, verstand sich die Sache noch von selbst: Natürlich gibt es einen Himmel, in den der liebe Gott alle lieben Menschen nach ihrem Tod aufnimmt – und hoffentlich auch meinen Wellensittich. Dass es einen Gott vielleicht gar nicht gibt – dieser Gedanke kam mir erst, als ich bereits in der Pubertät war. Dann aber traf er mich umso heftiger.
Bald änderten sich die Vorzeichen: Die Ablehnung eines Gottes verband sich mit der Auflehnung gegen erstarrte gesellschaftliche Konventionen – oder gegen das, was ich dafür hielt. Aber nicht an einen Gott zu glauben blieb eine düstere Angelegenheit: Es bedeutete, der schrecklichen Realität ins Auge zu sehen, dass alles sinnlos ist.
Erst später habe ich gelernt, dass man auch auf optimistische Weise Atheist sein kann. „Neue Atheisten“ wie Richard Dawkins (*1941) und Susan Blackmore (*1951) begreifen die Überwindung der Religion als Chance, unbelastet von irrationalen Ängsten das Leben zu genießen. Sie sind überzeugt, dass die Menschen glücklicher wären, wenn sie ihre religiösen Vorstellungen aufgeben würden. Deshalb gehen sie auf Konfrontationskurs zur Religion. Dabei setzen sie vor allem auf Argumente aus den Naturwissenschaften.
Als Jugendlicher konnte ich mir nicht vorstellen, dass Naturwissenschaften oder Mathematik zu der Frage nach einem Gott und dem Sinn des Lebens irgendetwas beitragen könnten. Sich mit Biologie zu befassen, um dem Rätsel des Lebens auf die Spur zu kommen: Das erschien mir so abwegig, wie sich mit der Papierqualität eines Buches zu beschäftigen, statt es zu lesen.
Als sich gegen Ende meiner Pubertät der Glaube an einen Gott wieder durchsetzte, geschah das nicht durch logische Argumentationsfiguren, sondern durch starke Erlebnisse, die ich religiös deutete. Eines dieser Schlüsselerlebnisse entzündete sich an einem Bändchen, von dessen Umschlag mich ein gesammelter Blick durchdringend anblickte: „Ich und Du“, eine Schrift des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965).
Das Buch aufzuschlagen und die ersten Zeilen zu lesen war eine Offenbarung. Ich war so ergriffen, dass mir gar nicht auffiel, dass Buber nicht etwa argumentierte oder begründete, sondern behauptete: So ist es. Er tat das so überzeugend, dass ich ihm unwillkürlich glaubte.
Wie konnte das geschehen? Später dachte ich mir: Offenbar haben wir Menschen ein tiefes Bedürfnis zu glauben. Wenn wir zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise darauf angesprochen werden, dann geben wir alle Bedenken auf und glauben, auch ohne Gründe.
Ich fragte mich: Wie soll ich mit diesem Verlangen nach Glauben umgehen? Soll ich mich ihm überlassen, um zu Gott zu finden? Oder soll ich diesem Bedürfnis widerstehen, um keinen Wahnvorstellungen zu erliegen?
Nach einer chaotischen Pubertät wollte ich mich neu sortieren und dabei alles richtig machen. Ich wurde sehr fromm, auf eine unnatürlich bigotte Art, wie ich es heute sehe. Überzeugt, dass ich die Existenz Gottes beweisen könne, begann ich, Philosophie zu studieren. Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (1787) überzeugte mich jedoch davon, dass man Gott nicht beweisen kann. Ich gewann den Eindruck, dass die Philosophie sich heute nicht mehr mit der Frage nach Gott beschäftigt, und verlor deshalb das Interesse an ihr.
Als meine Tochter und mein Sohn heranwuchsen, erlebte ich erneut, dass in der Religion Kräfte schlummern, denen rational nur schwer beizukommen ist: Eine Sehnsucht wurde in mir übermächtig, meine Kinder in denselben katholischen Traditionen aufwachsen zu sehen, mit denen ich selbst als Kind glücklich gewesen war. Aber was mir damals Geborgenheit gegeben hatte, ließ sich nicht mehr wiederherstellen.
Die Bindekraft religiöser Traditionen erlebte ich erneut, als ich 2016 aus dem Texter- in den Lehrberuf wechselte, um Geflüchtete in Deutsch zu unterrichten. Aber ich erfuhr auch, dass sich nicht wenige Geflüchtete von dem Glauben ihrer Vorfahren abwenden. Oft sind sie aufgebracht wegen des entmündigenden religiösen Zwangs, dem sie in ihren Heimatländern ausgesetzt waren.
Unsere Religionsfreiheit ist äußerst attraktiv für Menschen, die das Gegenteil kennenlernen mussten. Aber wie frei sind wir wirklich in unserer Entscheidung? Bin ich durch meine Erziehung nicht viel zu stark vorgeprägt, als dass ich die Argumente der Gegenseite überhaupt noch aufnehmen könnte?
Falls es so sein sollte, würde mein Glaube auf tönernen Füßen stehen. Deshalb wollte ich der Sache auf den Grund gehen: Schaffe ich es, die Argumente, die gegen meine Überzeugung sprechen, mindestens genauso ernst zu nehmen wie die Argumente, die mich bestätigen? Die Frage, ob es etwas Übernatürliches gibt, ist mir zu wichtig, als dass ich beiseite schieben dürfte, was dagegen spricht. Zumal wenn es von Wissenschaftlern kommt. Ob Pro oder Contra, alles muss auf den Tisch. Dieses Buch ist mein Versuch, diesem Anspruch gerecht zu werden.