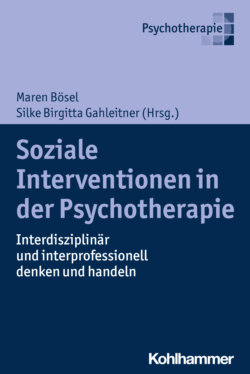Читать книгу Soziale Interventionen in der Psychotherapie - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Das biopsychosoziale Modell als Grundlage kooperativer multidisziplinärer Intervention
ОглавлениеDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in verschiedenen umfassenden globalen Rapporten, z. B. den Weltgesundheitsberichten (WHO, 2001b, 2003), die biopsychosoziale Forschungsevidenz beschrieben, mit der heute die grundlegenden Determinanten psychischer und psychosozialer bzw. soziosomatischer Gesundheit aufgezeigt und definiert werden können. Es gibt einen beeindruckenden wissenschaftlichen Konsens, dass gewisse Voraussetzungen sowohl auf gesellschaftlichem Niveau als auch individuell gegeben sein müssen, um Gesundheit zu fördern und Krankheit und Dysfunktion zu verhindern bzw. zu behandeln. Diese Faktoren werden maßgeblich durch die soziale Lebenslage der Menschen im gesellschaftlichen Wandel beeinflusst, auch wenn dann im Einzelfall Gesundheit oder Erkrankung Konsequenz individueller Lebensweisen, Lebenskrisen oder krankheitsbedingter Funktionsverluste sind (Rutz & Pauls, 2017).
Diese Erkenntnisse gingen ein in das biopsychosoziale Modell der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der WHO (2001a; dt. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, ICF; Abb. 1.1). Sie liefert eine länder- und fachübergreifende, einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung und der relevanten Umgebungsfaktoren einer Person. Erfasst werden Behinderungen und Beeinträchtigungen der Person, ihre Aktivitäten und ihre Situation sowie ihre Teilhabemöglichkeiten im Alltag. Die Abklärung von Ressourcen und Defiziten (Beschreibung krankheits- oder altersbedingter funktionaler Probleme) ist Voraussetzung für gezielte medizinische, psychologische und soziale Prävention und Intervention.
Abb. 1.1: Das biopsychosoziale Modell der ICF (aus DIMDI, 2005; © Copyright WHO, DIMDI, 2001–2012)
Das biopsychosoziale Modell gibt mit solchen Strukturierungen klinischer Behandlung eine Anleitung, wie Leiden und Krankheit auf verschiedenen Integrationsebenen, von der sozialen bis zur molekularen, angegangen werden können (Borrell-Carrió, Suchman & Epstein, 2004, S. 576). Seine Relevanz für das praktische sozialarbeiterische Vorgehen bei klinischen Aufgabenstellungen wird von Applegate und Shapiro (2005) folgendermaßen charakterisiert:
»The biopsychosocial integration offers a rigorously conceptualized and research-based explanatory framework for understanding how the clinical relationship works. For social work this formulation validates and privileges the quiet, sustaining, and supportive relational backdrop to the range of interventions, from assisting individual clients with emotional problems, to advocating with others on their behalf, to gaining cooperation of others toward modifying aspects of clients’ external environments. The emphasis on attachment dynamics as key to successful intervention puts as much, if not more, emphasis on the experience of ›being with‹ the client than on ›doing for‹ him or her« (S. 157).
Gemeinhin werden psychosoziale Beratung, soziale Unterstützung und Hilfen der Sozialen Arbeit als Bearbeitung von »Mittelproblemen« und dazu notwendigen Handlungsregeln verstanden, die man in Bezug auf die Lösung von sozialfunktionalen und sozialstrukturellen Problemen benötigt. Folgt man Applegate und Shapiro (2005), ist diese Betonung des Mittelbezuges zwar durchaus zutreffend, doch ebenso zutreffend ist, dass klinisch-sozialarbeiterische Fallarbeit es in hohem Maße auch mit kognitiv-emotiven Betroffenheiten der Menschen zu tun hat, die zugleich Orientierung und psychosoziale Beratung suchen und professionelle Hilfe bei der Auffindung oder Aktualisierung von Mitteln zur Problemlösung in ihrer Lebenssituation benötigen. Um sich auf die Bearbeitung der Mittelprobleme einzulassen, die sich in der Regel als engstens verzahnt mit Problemen der kognitiven wie emotionalen Orientierungsfindung erweisen, ist eine differenzierte und professionelle – oft langfristige – Beziehungsgestaltung erforderlich (Gahleitner, 2017). So präsentieren sich beispielsweise grundlegende Lebensorientierungsfragen sehr häufig zunächst als Mittelprobleme (z. B. Schulden), die nicht rein argumentativ bzw. »sachlich« beratend angegangen werden können.
Hier kommt auch deutlich die notwendige interdisziplinäre Kooperation der Psychotherapie mit der Sozialen Arbeit ins Spiel. Erst wenn jemand in der Lage ist, die eigenen Probleme mit dem eigenen Handeln und Erleben in Verbindung zu bringen, sie also nicht nur zu externalisieren, ist Veränderung durch eigenes Handeln in der sozialen Umgebung möglich. Ein erlebter Selbstbezug ist für die psychotherapeutische Bearbeitung normalerweise Voraussetzung für eine erfolgversprechende Behandlung. Gar nicht so selten kann ein solcher Selbstbezug jedoch erst in einem längeren klinisch-sozialarbeiterischen bzw. sozialtherapeutischen Hilfeprozess als Voraussetzung einer Psychotherapie oder diese begleitende Maßnahme erreicht werden. Es geht hier um einen bedeutsamen Teil der Klientel der (Klinischen) Sozialarbeit. Die Betroffenen befinden sich meist in einer Situation subjektiv und objektiv stark eingeschränkter Kontrollierbarkeit des Geschehens (also unter starkem Situationsdruck), wodurch sie ungewollten und unerwünschten negativen Erfahrungen und Situationen ausgesetzt sind, die sie in der Regel im subjektiven Erleben wahl- und chancenlos über sich ergehen lassen müssen (so zumindest ihre Wahrnehmung). In der Folge haben sie kaum einen Sinn für eigene Bewältigungskompetenzen (»mastery«) und für eigene Einfluss- oder Einwirkungsmöglichkeiten (im Sinne eines internen »locus of control«). Sie gelten oft als »hard to reach« (Labonté-Roset, Hoefert & Cornel, 2010; Gahleitner, Schulze & Pauls, 2009).