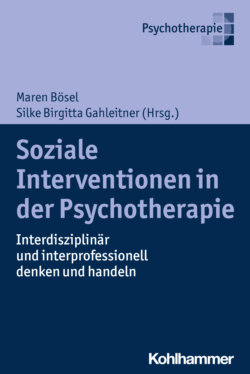Читать книгу Soziale Interventionen in der Psychotherapie - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Soziale Arbeit und Psychotherapie – ein schwieriges, jedoch auch fruchtbares Verhältnis Maren Bösel, Silke Birgitta Gahleitner und Helmut Pauls
ОглавлениеDer Einfluss von sozialen Faktoren auf die Entstehung von Krankheiten und die Forderungen nach geeigneten Konzepten der Sozialen Therapie rückten bereits vor über 100 Jahren in das Blickfeld von Medizin und Sozialer Arbeit. Den Menschen in seiner Ganzheit mit Körper, Geist und Seele zu sehen, forderte bereits Krehl (1898) als einer der ersten Mediziner. Er übernahm 1907 die Leitung der Medizinischen Klinik in Heidelberg (vgl. Gänshirt, 1986). Weizsäcker als Schüler von Krehl führte die Abteilung in seinem Sinne weiter und installierte die Soziale Therapie 1947 als Methode in der Behandlung von psychosomatischen PatientInnen. Er sah die Sozialtherapie als ärztliche Therapie für PatientInnen, bei denen die psychotherapeutische Behandlung nicht zum Erfolg führt. In diesen Fällen sollte versucht werden, die sozialen Faktoren der PatientInnen zu verändern, die zum Krankheitsgeschehen geführt hatten.
Weizsäcker (1947, 1930/1986) schreibt in seinen Ausführungen zwar die Soziale Therapie als Aufgabe den ÄrztInnen zu und nicht der Sozialen Arbeit, dennoch hat er mit seinem sozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit einen wichtigen Beitrag für die Soziale Arbeit geleistet, auch wenn die Würdigung seiner Arbeit vorrangig im Bereich der psychosomatischen Medizin erfolgte und bis heute erfolgt (vgl. Hahn, 2014). Mitscherlich wiederum als Schüler Weizsäckers gründete 1950 die erste Psychosomatische Klinik (vgl. Bräutigam, 1986). Dort wurde begonnen zu untersuchen, welche seelischen und sozialen Faktoren zur Entstehung von neurotischen, psychosomatischen und organischen Krankheiten führen können. Bereits in den 1970er-Jahren unterstützte eine Sozialarbeiterin die Arbeit der behandelnden ÄrztInnen und PsychologInnen in der dortigen Klinik.
Auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit machten Anfang des 20. Jahrhunderts Richmond (1917) und Salomon (1926/2002) mit der Forderung nach Konzepten Sozialer Therapie aufmerksam. Sie empfahlen, dass soziale Kontextfaktoren routinemäßig im Verlauf eines diagnostischen Prozesses erhoben werden und somit in der Planung der daraus folgenden Interventionen Beachtung finden. Nach ihrer fachlichen Einschätzung war es für die Planung der Interventionen notwendig zu verstehen, wie man Menschen darin unterstützen kann, sich in den Gegebenheiten ihrer Umwelt zurechtzufinden und sich darin zu behaupten, bzw. inwiefern der Schwerpunkt auf der Umgestaltung der sozialen Rahmenbedingungen liegen sollte, damit sich KlientInnen entfalten können.
In den USA entwickelte sich in den 1920er- und 1930er-Jahren eine fruchtbare Begegnung von Psychotherapie und Sozialer Arbeit (detailliert rekonstruiert von Heekerens, 2016): Rank, Robinson und Taft waren wichtige Wegbereiter der Humanistischen Schule im Kontext von Social Case Work und »Functional School«.1 Diese Arbeiten hatten weitreichenden Auswirkungen auf die Konzepte von Rogers (1957) zur Klientenzentrierten Therapie, auf das Psychodrama und die Gestalttherapie.
Trotz dieser historischen Traditionen und mannigfaltigen Versuche der Annäherung ist das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Psychotherapie in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum nach wie vor von Spannungen charakterisiert (in den USA gibt es traditionell ein wesentlich offeneres Verhältnis, dort gehört eine Mehrheit der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dem Berufsstand der Social Worker an). Im Folgenden wird sich diesem Phänomen von verschiedenen Seiten aus angenähert.