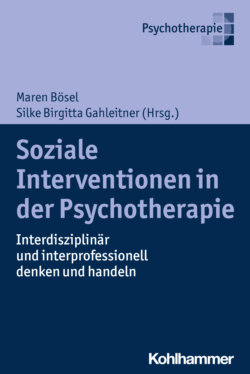Читать книгу Soziale Interventionen in der Psychotherapie - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Sozial sensitive Therapie
ОглавлениеEine ernsthafte Anwendung des biopsychosozialen Modells bedeutet nicht, die drei Integrationsebenen nur lose nebeneinander bestehen zu lassen oder eine Ebene durch eine andere zu ersetzen (Reduktionismus). Es geht nicht darum, somatische Konzepte durch psychologische oder soziale zu ersetzen oder umgekehrt, sondern alle drei in der Versorgung zu verbinden (vgl. auch Ansen, 2001, S. 3). Sachgerecht erscheint heute die sorgfältige Beachtung aller Manifestationsebenen von Gesundheitsproblemen, die jeweils auf den unterschiedlichen Ebenen und in ihrer wechselseitigen Verflechtung und Wechselwirkung zu diagnostizieren und ggf. interdisziplinär und kooperativ zu behandeln sind. Für die Intervention im Sinne sozial sensitiver psychotherapeutischer Behandlung bedeutet dies, soziale Prozesse mit psychischen bei der Aufgabenbewältigung zu synchronisieren. Sommerfeld, Hollenstein und Krebs (2008; vgl. auch Sommerfeld, Hollenstein & Calzaferri, 2011) sehen die Aufgabenstellung Sozialer Arbeit dabei in der Koordination und Synchronisation psychischer und sozialer Prozesse im Sinne eines »integrierten Prozessbogens« (Sommerfeld et al., 2011, S. 326). Primäre sozialarbeiterische Aufgabenstellungen liegen in der Arbeit an Formen der Integration von lebensweltlichen Kontexten der Klientel, wobei man sich dabei häufig auch in der Lebenswelt der KlientInnen, in ihren »Lebensführungssystemen«, (aufsuchend) bewegt ( Abb. 1.2). Der psychotherapeutische Blickwinkel beinhaltet die Abklärung und Bearbeitung der psychologischen Problematik im Sinne individueller psychischer kognitiv-emotiver Funktionsmuster und ihr Zusammenwirken mit psychophysiologischen Prozessen. Die biomedizinische Perspektive beinhaltet eine somatische Betrachtungsweise und beurteilt eine eventuelle medikamentöse Versorgung der PatientInnen, auch unter Beachtung individueller psychischer Komponenten. Die Soziale Arbeit ist zuständig für die Unterstützung deren sozioökonomischer Angelegenheiten (Lebenslagesicherung) sowie Beratung und aktive und ggf. aufsuchende soziale Unterstützung unter Einbezug der Mitwelt (Angehörige und das weitere soziale Umfeld).
Abb. 1.2: Formen der biopsychosozialen Integration und die von der Sozialen Arbeit einzubeziehenden »Lebensführungssysteme« (aus Sommerfeld, Hollenstein & Krebs, 2008, S. 13)
Indem bspw. die Angehörigen oder auch Lehrkräfte in Schulen (z. B. in Inklusionsklassen) zu DialogpartnerInnen werden, zugleich professionelle soziale Unterstützung zur Erschließung sozialer Unterstützungsleistungen erhalten und psychosoziale Beziehungsberatung und sozialtherapeutische Begleitung erfahren, werden sie darin gestärkt, die auf sie gelegten Beanspruchungen zu tragen. KlientIn Klinischer Sozialarbeit ist deshalb oft nicht das individualisierte Subjekt allein, sondern das »Individuum-in-seiner-Welt« (»person-in-environment«; Dorfman, 1996).
Milne (1999, vgl. Pauls, 2011/2013b) fordert, im Rahmen einer social sensitive therapy das soziale Umfeld grundsätzlich als wesentlichen Wirkfaktor in die therapeutische Behandlung einzubeziehen. Zur Veranschaulichung führt Tabelle 1.1 typische soziale bzw. sozialtherapeutische Person-in-environment-Interventionsstrategien auf ( Tab. 1.1).
Tab. 1.1: Soziale Unterstützungsinterventionen im Rahmen sozialer Behandlung (Pauls, 2011/2013b, S. 322 f., modifiziert nach Milne, 1999)
InterventionsstrategieZieleMethoden
Die für die psychotherapeutische Perspektive wichtigen Dimensionen des Selbstbildes und der Selbstbewertung (die sich ja wesentlich in Interaktion mit und Abhängigkeit von ihren Mitmenschen entwickeln, destabilisieren oder stabilisieren) werden in den Interventionssettings und -methoden der Klinischen Sozialarbeit insbesondere durch die konkrete Erfahrung eigener Handlungsfähigkeit gefördert, immer auch im Rahmen von Bindung und Halt gebenden helfenden Beziehungen (Gahleitner, 2017). Sozial bzw. psychosozial beratende und behandelnde Maßnahmen Sozialer Arbeit bieten entsprechend Projekte mit einbindungs- und handlungsbezogenen Erfahrungsmöglichkeiten im Rahmen von stabilen – heilsamen – Anerkennungsverhältnissen. Dazu sind geeignete sozialstrukturelle Arbeitsbedingungen nötig (z. B. institutionelle Angebote, Projekte, Werkstätten, Gruppen), welche (a) die sozialemotionale Motivation der Betroffen durch spezifische Handlungsmöglichkeiten fördern und soziale Anerkennung hervorrufen sowie Zugehörigkeit ermöglichen und (b) den Betroffenen Selbsteinbindungsmöglichkeiten und positive Selbstregulationsmöglichkeiten (Selbstwirksamkeitserfahrungen, positive Selbstbewertung) anbieten (Pauls, 2011/2013b).
Um dem biopsychosozialen Modell in der Praxis gerecht zu werden, schlägt Egger (2005) Simultandiagnostik und kooperative Behandlung vor: Analyseebenen, Datenquellen und jeweilige funktionale Bereiche sollten medizinische ExpertInnen auf der biologischen Ebene, psychologische ExpertInnen auf der psychologischen Ebene und SozialexpertInnen auf der sozialen Ebene abklären bzw. einbringen. Anschließend wird im Rahmen einer ganzheitlichen Diagnostik ein integrativer biopsychosozialer Behandlungsplan entwickelt ( Abb. 1.3).
Abb. 1.3: Simultandiagnostik und -therapie (aus Egger, 2005, S. 10)