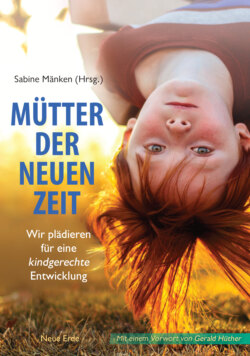Читать книгу Mütter der Neuen Zeit - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Kunst der Mütterlichkeit
ОглавлениеSara liebt ihren Beruf als Kunsthistorikerin. Und sie liebt ihre Kinder. Eigentlich hätte sie allen Grund gehabt, für Fremdbetreuung dankbar zu sein. Doch schon ihre Mutter hatte sie gelehrt, »out of the box« zu denken. Für sie ist es das Leben selbst, das sie einlädt, ihren Kindern Zeit zu schenken und mit ihnen im Hier und Jetzt anzukommen.
Auf dem weinroten Teppich, den unsere Vormieter hinterließen, klebt ein gräulicher Kaugummi, für immer untrennbar verschmolzen mit dem Teppichgewebe. Er ist schon immer dagewesen, keiner war‘s. Der Samstagnachmittag ist noch lang, und ich habe es mir bäuchlings auf dem Boden liegend gemütlich gemacht. Die Ideen sprudeln.
Es ist 1989. Wir leben in Basel in einer einfachen Dreizimmerwohnung am Stadtrand. Mit meinem silbernen Füller kritzle ich die Geschichte über ein fast unbekanntes Bergdorf tief in den Schweizer Alpen auf ein weißes Stück Papier. Meine Mutter möchte unbedingt wissen, wie sie ausgeht und ermutigt mich, weiterzuschreiben. Wie am Fließband erfinde ich zur Zeit die wildesten Erzählungen. Märchen und Selbsterlebtes fließen nahtlos ineinander, mein kleiner Bruder hängt mir an den Lippen. Meine Mutter nimmt viele meiner Live-Erzählungen auf Tonband auf. Diese aber schreibe ich auf. In der Küche klappern die Töpfe, der Duft von frisch gebackenem Brot steigt mir in die Nase, die Meerschweinchen quieken aus ihrem Stall heraus, mein Bruder spielt mit seinen Legosteinen und auf dem Schreibtisch meiner Mutter stapeln sich Seminararbeiten, Schulbücher und Kunstbildbände. Sie ist Lehrerin.
Als ich fertig bin, entziffert sie gespannt meine fantastisch-lakonische Story, schmunzelnd, gerührt, mütterlich stolz. Sie lacht! Die Geschichte handelt von »unserem« Dorf, und es ist eine so komische Geschichte, dass sie es sogar ins Schweizer Radio schafft. Denn meine stolze Mutter schickt den Text zu einem Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Sie ermutigte mich auch später immer, meine Ideen durchzudenken, aufzuschreiben, mich auszuprobieren und »out of the box« zu denken.
Der Impuls, zu promovieren entstand bei mir kurz nach der Geburt meines ersten Kindes. Ich fühlte eine ungeheure Energie und Euphorie in mir, obwohl es eine schwere Geburt und meine Tochter ein wirklich anspruchsvolles Baby war. Neugeboren lehrte sie mich, dass sie möglichst rund um die Uhr getragen und viel mehr gestillt werden möchte, als ich es mir zuvor vorgestellt und auch sagen lassen habe. Der Stubenwagen stand bei uns schnell nur noch als hübsche Innendekoration im Wohnzimmer und verschwand alsbald im Keller. Mit Selmas Geburt wurde aber nicht nur ein neues Kind geboren, sondern auch ich fühlte mich als ganz anderer Mensch. So viel Liebe, so viel Energie, so viele und starke, intensive Emotionen. Auch ich war wie neugeboren im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war ein anderer Mensch. Und jedes neugeborene Kind wurde zur Liebe meines Lebens. Nur fünfzehn Monate später kam mein erster Sohn zur Welt. Zwei Jahre darauf hatte ich ein großzügiges Promotionsstipendium und eine Vereinbarung mit dem Wissenschaftsverlag meiner Träume in der Tasche.
Natürlich wollte ich meine Doktorarbeit auch bewältigen und mir damit eine berufliche Zukunft als Autorin und Kunstwissenschaftlerin aufbauen. Mich interessierte das Thema ausgesprochen. Ich war ehrgeizig, vor allem wollte ich aber nicht im Kleinklein von Brotjobs versumpfen, sondern meinem Leben eine klare Richtung geben: Das Schreiben und Sprechen über Malerei und die Bildbetrachtung machten mich glücklich, warum also nicht daraus einen tragfähigen Beruf für mich kreieren?
Die beiden kleinen Kinder aber hielten natürlich nicht immer gleichzeitig und gleich lang ihre Siesta. Ihre nicht immer reibungslos planbaren Schlafenszeiten genügten mir nicht: Ich brauchte ein bisschen mehr Zeit für die konzentrierte Schreibarbeit. Meine zwei ersten Kinder gingen deshalb mit 2¼ Jahren beziehungsweise schon mit 13 Monaten zu ihrer Tagesmutter Bettina, damit ich an der TU Dresden meine Doktorarbeit über zeitgenössische Malerei verfassen konnte. Ich sah es schon damals nicht ein, weshalb meine ältere Tochter woanders fremdbetreut werden sollte, wenn ich mit dem zweiten Baby ohnehin zu Hause wäre. Deshalb ging sie für heutige Verhältnisse erst so spät in eine Tagesbetreuung.
Von unseren Familien erhielten wir leider so gut wie keine Unterstützung. Die Großeltern wohnten in einer anderen Stadt, und die Schwiegermutter erklärte mir rundheraus, sie hätte mit ihren fünf Kindern schon genug geleistet, nun lägen ihre Interessen woanders (in der Arbeit und der Erholung). Da es auch finanziell sehr schwierig war, entschied ich mich schließlich für die Tagesmutter. Es musste sich einfach etwas ändern, denn ich hatte es satt, immer am Rande des Existenzminimums zu vegetieren. Das Gehalt meines damaligen Mannes als Theaterschauspieler reichte trotz Festanstellung, großformatigen Plakaten und üppigem Applaus leider gerade so für die Basics – zum Glück bezahlte meine Mutter uns die wöchentliche Kiste mit Biogemüse vom Bauern, aber das nur am Rande. Es war eine rein rationale und auch aus der Not getroffene Entscheidung, die beiden kleinen Kinder in fremde Hände zu geben. Mein Mann konnte sich nicht dazu durchringen, seine Arbeitszeiten zugunsten der Kinder und mir einzuschränken. Innerlich waren weder ich noch Selma und Timon soweit, einen wesentlichen Teil des Tages getrennt zu verbringen, nicht mehr morgens miteinander auf den Spielplatz zu gehen, durch den Auwald zu abenteuern, nicht mehr gemeinsam »Zmittag« zu kochen und zu essen und auf die ruhige Geborgenheit der Siesta zu Hause zu verzichten. Für mich war es eine seltsame Vorstellung, die Kinder woanders schlafen zu lassen.
Sicher hat das auch viel mit meiner Schweizer Sozialisierung zu tun, wo es die längste Zeit einfach nicht üblich war, Kleinkinder überhaupt fremdbetreuen zu lassen und der Kindergarten auch heute nur drei bis vier Stunden am Vormittag dauert. Doch ganz unabhängig davon musste ich zusehen, wie meine Kinder bei fast jedem Abschied heulten. Zwar erklärte uns die liebevolle Tagesmutter geduldig, dass dies ganz normal sei und sie sich beruhigen würden, für mich aber fühlte es sich falsch an. Eigentlich hätte ich die beiden quirligen Zwerge lieber immer um mich gehabt oder aber sie in den Händen von Familienmitgliedern gewusst.
Mir fehlten meine Großmütter, meine Tanten und Schwestern, meine Freundinnen. Für meinen Mann war ich (von Berlin) nach Leipzig gezogen, wo ich niemanden kannte. Im Grunde genommen fühlte ich mich einsam und auch teils überfordert von den andauernden existenziellen Bedürfnissen der Kinder. Mit der bisherigen Gleichberechtigung war es nach den beiden Geburten nämlich schlagartig vorbei. Mein Mann tauchte tagsüber jeweils für ein paar Stunden auf, um die Kinder nachmittags mit seinen Schauspielkünsten zu bespaßen und zu bezirzen – für den nicht immer zuckersüßen Rest war im Wesentlichen ich zuständig. Er nahm damals noch nicht einmal die sonst üblichen zwei Monate Elternzeit. Sie tagsüber für ein paar Stunden betreuen zu lassen, war damals die einzige Lösung. Weder konnte ich mir mein Netzwerk in die fremde Stadt zaubern noch meinen Mann dazu bewegen, mehr da zu sein.
Mit Bettina hatten wir großes Glück: Neben meinen beiden Kindern betreute sie nur noch eine Spielkameradin meiner Kinder, die wir ohnehin regelmäßig trafen. Wir brachten sie um 9 Uhr morgens und holten sie nach der Siesta so früh wie möglich ab, oft ließ ich sie auch ein oder zwei Tage zu Hause, fuhr mit ihnen zu meiner Verwandtschaft und den Freunden in Basel. Das war mein Kompromiss. Unsere Tagesmutter war der pure Luxus im Vergleich zum regulären Betreuungsschlüssel: Ehrlich gesagt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich sechs Kindern unter drei Jahren so viel Kraft und Aufmerksamkeit entgegenbringen könnte, wie sie es zu Hause einfordern.
Heute bin ich 39 Jahre alt, geschieden und lebe in einer neuen Partnerschaft. Inzwischen bin ich mit Auszeichnung promovierte Kunsthistorikerin, mehrfache Buchautorin und stolze Mutter von drei Kindern. Unser Nesthäkchen kam vor zwei Jahren zur Welt, und die beiden großen Kinder sind jetzt zehn und zwölf Jahre alt. Der Kleine geht erst in den Kindergarten, wenn er wirklich reif dafür ist, von der Umgebung profitiert – und nicht in erster Linie, damit ich noch mehr meinem Beruf nachgehen kann. Meine beiden Fast-Zwillingskinder begannen, rückblickend betrachtet, erst im Alter von etwa dreieinhalb, vier Jahren, wirklich intensiv mit anderen Kindern zu spielen. Erst ab diesem Alter gingen sie auch gerne und von sich aus in den Kindergarten.
Vor kurzem brachen wir nach nur vier Wochen Valentins Eingewöhnung ab, weil er deutlich zeigte, dass er noch nicht so weit war. Unter anderem wurde er sehr krank, was mich zutiefst beunruhigte: Für mich war es ein deutliches Warnsignal, dass sein ganzer Körper auf diesen Löseprozess noch mit Stress und Überforderung reagierte. Die beiden Erzieherinnen unterstützten mich auf diesem Weg, und ich bin ihnen dankbar. Er ist wieder gesund, seitdem wir die Eingewöhnung beendet haben. Dies bestätigt mich in meiner Entscheidung, ihn weiterhin selbst zu betreuen.
Mit endlosen Spielnachmittagen, Verkleiden und Rollenspielen, gemeinsamem Backen, Malen, Erzählen und langen Spaziergängen habe ich meine eigene Kindheit sehr behütet und fröhlich in Erinnerung. Ich bin meiner Mutter dankbar für diese gemütliche und heile Kinderwelt. Meinen Vater dagegen empfand ich als streng, wenig kindgerecht in der Kommunikation und unberechenbar. Er hielt uns endlose Vorträge, egal, ob es uns interessierte oder nicht. Im Alter von sechs Jahren teilte ich ihm bei einem Besuch auf dem Flughafen mit, er bräuchte mir nicht immer alles zu erklären (es ging um die technische Funktion von Turbinen). Er nahm mich beim Wort, und heute führen wir die anregendsten und spannendsten Gespräche, die man sich nur wünschen kann. Bis heute bin ich der Meinung, dass Kindern oft viel zu viel und alles bis ins kleinste Detail erklärt wird; dabei ist es viel besser, sie die Welt selbst entdecken und erfahren zu lassen. Wenn sie fragen, genügen kleine, behutsame Hilfestellungen oder eine Antwort, die zu mehr Fragen einlädt, sodass zwischen Kind und Erwachsenem ein angeregtes Gespräch entstehen kann.
Ich wurde 1980 in Basel geboren und meine Mutter musste bald wieder in die Uni, wenn auch nur ab und zu, um ihr Studium abzuschließen. Bei meiner Geburt war sie 21 Jahre alt. Im Gegensatz zu unserer Betreuungssituation lebten meine beiden Großmütter vor Ort. Vor allem meine Großeltern mütterlicherseits leisteten damals einen gewaltigen Anteil an meiner Betreuung. Oft verbrachte ich das ganze Wochenende bei ihnen, und auch in der Woche passte meine Mima, wie ich sie taufte, zuhause auf mich auf. Krippen gab es so gut wie nicht.
Meine Großmütter waren sehr unterschiedlich. Sie gaben mir aber beide ein wohliges Gefühl von Geborgenheit und ein unerschütterliches Vertrauen in das Gute mit auf den Weg. Bis heute schöpfe ich Energie aus diesem Kraftquell. Hélène, die Mutter meines Vaters, hatte ein offenes, lebendiges Haus, in dem junge Musiker ein- und ausgingen. Hausmusik gehörte zum Alltag. Sie spielte hervorragend Klavier, obwohl sie nie Musik studiert hatte, sondern ausgebildete Krankenschwester war. Von ihr habe ich die Liebe zur Musik und zu Fremdsprachen, denn mit ihrer italienischen Putzfrau unterhielt sie sich auf Italienisch, mit ihren Kindern abwechselnd auf Schweizerdeutsch und Französisch. Bei ihr herrschte immer ein herrliches Sprachengewirr.
Ich erinnere mich daran, wie ich durch das sonnendurchflutete Wohnzimmer in ihrem Haus schlendere und eine junge Basler Musikerin mir antwortet, sie spiele schon seit zwanzig Jahren Geige – für mich damals ein unfassbar langer Zeitraum. Der erste Satz von Beethovens Frühlingssonate erklingt, zwischendurch wird immer wieder kurz für Fragen zur Phrasierung unterbrochen. Wir Kinder laufen drum herum oder setzen uns unter das Klavier, drücken die Pedale und kitzeln die Musiker an den Beinen, bis es uns oder ihnen reicht und wir uns ein anderes gemütlicheres Versteck suchen, zum Beispiel unter dem ovalen Esstisch. Nach dem Zusammenspiel trinken wir gemeinsam Schwarztee mit Milch oder Zitrone, und die Erwachsenen debattieren über alles mögliche. Bis heute spielt die Offenheit für andere Kulturen und damit einhergehend das fortwährende Lernen von Fremdsprachen in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Es bereichert unser Leben.
Linda, meine Mima, meine Großmutter mütterlicherseits, ist eine resolute, starke, sehr warmherzige und vor Energie nur so sprühende Frau. Jahrelang führte sie erfolgreich einen Irish-Shop mit Kleidung und vielem mehr von der Grünen Insel. Nichtsdestotrotz vermittelte sie mir, dass Kindererziehung und Haushaltsführung ein wichtiger Beruf sei, welcher ebenso gewissenhaft verfolgt werden könne, wie jeder andere Beruf auch. Als Jugendliche tippte ich mir an den Kopf, denn ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, was daran nützlich oder gar interessant sein sollte. Aber wenn wir zu ihr kamen, und das war oft, dann stand ein duftendes Essen auf dem Tisch, gebügelte Stoffservietten und eine Tischdecke gehörten obligat dazu. Und wir fühlten uns herrlich, gewürdigt und ernstgenommen. Für uns war es eine gediegene, edle Atmosphäre wie im Sternerestaurant, nur gemütlicher und herzlicher. Zudem: Tischmanieren ergeben in so einem Ambiente auf einmal Sinn! Wir sollten doch schon anfangen, rief sie uns aus der offenen Küche zu, damit das Essen nicht kalt werde. Alles war schön angerichtet, denn: Das Auge isst mit! – so ihr Credo. Sie übte mit uns für die Schule, drillte uns in Mathe, während unser Großvater für Deutsch zuständig war, und abends erzählte sie uns Geschichten, während am Esstisch und zwischendurch heftig über Politik debattiert wurde. Es war nie so, dass sie sich gelangweilt hätte, sie war immer in Bewegung, gerne auf Reisen oder draußen im Garten. Meine selbstbewussten Großmütter waren moderne Frauen und ganz bestimmt keine »Hausmütterchen«. Sie vermittelten mir, dass es eine wichtige Aufgabe ist, einen Haushalt in Form eines lebendigen Hauses zu führen, und dass hier auch anspruchsvolle Kultur möglich ist, sei es nun in Form von Tischkultur, der Kultur des Dialoges, der klassischen Musik, Literatur oder Kunst.
Meine beiden großen Kinder spielen inzwischen selbst Violine und Klavier. Oft »jammen« wir abends, improvisieren frei oder spielen klassische Stücke zusammen. In der Weihnachtszeit erklingen die Lieder mit zwei Geigen und Klavier, während der Kleine dazu trommelt, singt und rasselt. Er ahmt die Tätigkeiten der Großen nach. Gerne fordert er seinen Platz auf dem Klavierschemel ein und verlangt vehement nach Noten, wenn dort einmal keine stehen. Für uns ist es Spaß und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkende lebendige Kultur.
Fernsehen und Computerspiele dagegen betrachte ich als lästige Zeitverschwendung. Nirgends ist das Gehirn passiver als beim Fernsehen, selbst im Schlaf ist es aktiver (vgl. S. Aamodt/S. Wang, Welcome to Your Child’s Brain, München 2012). Nichtsdestotrotz halte ich die Kinder nicht komplett davon fern, aber als digitalen Babysitter würde ich diese Medien nie einsetzen. Gelegentlich, vielleicht einmal pro Woche, eine genaue Regel haben wir dafür nicht, schauen wir gemeinsam über Onlinedienste gezielt Dokumentarfilme oder auch einmal eine Unterhaltungssendung an. Mir ist es wichtig, dabeizusitzen, sodass wir direkt über aufkommende Fragen reden können.
Kinder alleine vor so einem Gerät »abzustellen«, empfinde ich als Vernachlässigung. Immer wieder sehe ich leider »vollverkabelte« Kinder mit Kopfhörern vor einem Tablet oder Smartphone, sei es nun zu Hause, im Auto, Zug, Restaurant oder in anderen vermeintlich »langweiligen« Situationen. Es gruselt mich regelrecht, wenn ich sehe, wie reglos die Kinder vor diesen Geräten ausharren. Es gibt keine andere Situation im Leben eines Kindes, wo es im Wachzustand derart hypnotisiert vor sich hinstarrt, bewegungslos, starr – und still. Mich erschreckt es, wie die Kinder heutzutage so bedenkenlos ruhiggestellt werden. Was sagt es über unsere Gesellschaft, wenn die Kinder die Erwachsenen nicht »stören« sollen? Sie sollen ihre Lebenskraft, ihre Neugier, ihren Bewegungsdrang, ihren Drang, sich zu zeigen, zu sprechen, sich auszutauschen nicht ausleben? Anstatt etwas gemeinsam zu tun oder sie dazu aufzufordern, sich eine eigene ruhige Beschäftigung zu suchen, werden sie geradezu »abgestellt«. Nichts anderes als das ist es nämlich!
Um unterwegs gelangweiltem Gejammere vorzubeugen, trage ich oft dem Kind entsprechende Bücher bei mir. Wir schauen sie uns zusammen an und erleben dadurch eine wunderbare Zweisamkeit. Tagsüber gehen wir spazieren, fahren Rad, lesen oder sitzen auf dem Balkon, kümmern uns um die Pflanzen, die wir dort wachsen lassen. Es gibt immer etwas zu tun. Wir kochen täglich und backen gelegentlich zusammen. Meistens fange ich an und nach und nach stellen sich die Kinder von sich aus dazu, machen mit, schnappen sich Messer und Brettchen, rüsten Gemüse, schnippeln, werden selbst kreativ, indem sie sich eigene Gerichte ausdenken. Ich lasse sie gerne einfach machen und sorge lediglich für geeignete Rahmenbedingungen. Der Kleine schiebt sich einen Stuhl zur Arbeitsplatte und möchte mitschneiden, rühren, sehen, wie das Olivenöl in der gusseisernen Bratpfanne Muster bildet, wie die Butter zerläuft, die Zwiebeln glasieren und der frische Spinat beim Kochen zusammenfällt. Den täglichen gemeinsamen Mahlzeiten geht ein Tischlied voraus, das gehört fest dazu; abends lese ich den Kindern vor. Oft spiele ich auch nur für mich Geige, eine Mozart-Sonate, Telemann, oder aktuell einen kniffligen Sarasate. Die Kinder beschäftigen sich in dieser Zeit wunderbar selbst, Valentin schnappt sich ein Bilderbuch und macht es sich auf dem Sofa gemütlich oder klimpert auf dem Klavier. Und manchmal singt er lauthals mit.
Für mich war es eine reine Herzensentscheidung, Mutter sein zu wollen. Es ist nicht so, dass ich mir schon mein Leben lang Kinder gewünscht hätte. Wirtschaftliche oder organisatorische Erwägungen spielten bei der Familienplanung keine Rolle. Wenn sie das getan hätten, wäre ich heute nicht Mutter, denn ich hätte es mir objektiv betrachtet wohl nicht leisten können. Das Kind sehe ich als selbständige Person, die ihren eigenen Weg geht. Es ist für mich daher kein Widerspruch, aus ganzem Herzen Mutter und für die Kinder voll da sein zu wollen, und trotzdem (oder gerade deswegen) eigenen Interessen konsequent nachzugehen. Meistens saß ich schon wenige Tage nach der Geburt wieder an meinen Texten und arbeitete, schrieb und telefonierte beruflich. Weil mir meine Arbeit auch Kraft gibt.
Eigentlich hätte ich durch meinen Beruf allen Grund gehabt, für Fremdbetreuung dankbar zu sein. Doch diese mantrisch vorgetragene Frage, wann ich denn mein Kind in die Kita brächte, entpuppte sich schnell als Denkbox. Ich suchte unseren eigenen Weg. Think outside the box. Was von Anfang an klar war: Mein Kind soll in dieser so prägenden Lebensphase von Menschen umgeben sein, die es aus ganzem Herzen lieben und ihr Leben lang für es da sein werden. Die Erzieher in Kitas arbeiten oft unter schlechten Bedingungen. Sie sind Profis, was ich in diesem Zusammenhang durchaus als Nachteil empfinde, denn wenn die Zeit im Kindergarten endet, dann endet auch die Beziehung zwischen Kind und KindergärtnerIn abrupt. Ein schmerzhafter Vorgang.
Bedenklich ist für mich ohnehin die eigentliche Karikaturierung des Kindergartens. Ursprünglich gegründet, um den Kindern zu dienen, ihr Leben zu bereichern, bedient er heute im Wesentlichen die Bedürfnisse eines gefräßigen Arbeitsmarktes, der die produktivste Zeit und Kraft der Eltern beansprucht. Oder warum müssen die Kinder unter alles anderen als idealen Bedingungen einen großen Teil der prägenden Wachzeit dort verbringen, oft bis zu neun Stunden am Tag oder sogar noch mehr? Sicherlich sind die Räume hübsch bunt angemalt und die Klobecken niedriger, kindgerecht, aber sonst? Bei meinen Großen erinnere ich mich, wie ich die Geräuschkulisse in diesem recht kleinen christlichen Kindergarten mit »nur« siebzig Kindern so unerträglich laut und die Räume im Winter überheizt fand, dass ich möglichst schnell weg wollte. Wie kann eine solche Umgebung dann so jungen und voll in der Entwicklung stehenden Menschen ganztags zuträglich sein?
Kleinkinder haben empfindliche Ohren, und Ohren können sich nicht regenerieren. Auch das ist für mich ein Grund, mein Kleinkind nicht unnötig dem häufig enorm hohen Lärmpegel aussetzen zu wollen. Hinzu kommen die immer gleichen Abläufe oder der Mittagsschlafzwang, aber ich schweife ab! Kurz gesagt, bekommen Kinder unter vier bis fünf Jahren in einem normal aktiven Alltag mehr als genug Eindrücke, die auf ihr Tempo und ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können, während sie in einer Einrichtung größtenteils »funktionieren« müssen und eingetaktet werden. Während die Betreuung bei der Tagesmutter für die Fast-Zwillinge Stress bedeutete, freut unser Kleiner sich jetzt auf die gelegentlichen Besuche seiner Babysitterinnen, denn es sind seine Freundinnen und beinahe schon Familienmitglieder.
Oft habe ich durch die aktuelle Arbeitsmarktsituation und Familienpolitik leider das Gefühl, dass es der größte Luxus überhaupt ist, seine Kinder selbst zu erziehen. Das erscheint mir irrwitzig und stimmt mich oft sehr traurig. Gesellschaftlich erscheint es inzwischen als das Normalste der Welt, kleine Kinder spätestens mit vierzehn Monaten ganztags in eine Gruppenbetreuung zu bringen, wohingegen das Zuhausebleiben eben als »schön, wenn du es dir leisten kannst« kommentiert wird. Dadurch fühle ich mich in meiner täglichen sehr anstrengenden Tätigkeit auch abgewertet, auf jeden Fall nicht unterstützt. Oft bzw. meistens fehlt die Anerkennung. Teilweise sind die gegenwärtigen Erfahrungen recht frustrierend, wenn man nicht über eine große Portion Eigenüberzeugung verfügt. Wirtschaftlich finde ich es belastend, denn einerseits hat man höhere Ausgaben mit Kind und andererseits ein deutlich geringeres Einkommen, weil die Arbeit unbezahlt ist.
Manche erklären mir, ich dürfe nicht klammern, müsse mein eigenes Leben leben. Als ob das Aufwachsensehen und -begleiten meiner Kinder nicht zu meinem Leben gehörten!? Ich soll es an »Profis« delegieren, weil sie es besser könnten und die Kinder die »Sozialisierung« schon mit einem Jahr bräuchten? Ich bin aber der Meinung, dass es Dinge im Leben gibt, die man besser selbst erledigt. Glaube und Überzeugungen helfen dabei definitiv. Es ist meine innere Überzeugung, wie wichtig diese große Liebe ist, die nur Eltern ihren Kindern entgegenbringen können, die all das erst ermöglicht. Sie wird begleitet von der Freude daran, die zahlreichen täglichen Entwicklungsschritte direkt zu erleben, zu beobachten und zu begleiten. Zum Glück höre ich auch immer wieder ermutigende Bemerkungen wie: »Deine Kinder werden es dir danken.« Leicht wird vergessen, dass selbst größere Kinder mit zehn, elf Jahren noch recht viel Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigen. Meine beiden Großen genießen es, wenn sie nach der Schule ein duftendes Essen und ein offenes Ohr erwartet…
Für die Zukunft junger Eltern wünsche ich mir eine Anerkennung wenigstens in Form angemessener Rentenpunkte, wenn nicht gar ein Betreuungsgehalt als Ausgleich und Ausdruck der Wertschätzung für diese gesellschaftlich relevante Arbeit. Teilzeitarbeit sollte zum Standard werden, junge Väter nicht mehr, sondern weniger arbeiten, sodass die Elternteile sich mehr in die Betreuung einbringen können. Meistens bleibt es bedauerlicherweise weiterhin fast allein an den Frauen hängen. Beide sollten sich für die tägliche Pflege und Erziehung des Kindes verantwortlich fühlen und ihre Arbeitszeit außerhalb der Familie reduzieren.
Richtig wütend macht es mich allerdings, dass der erste Brief zur Geburt meines Sohnes vom Finanzamt kam und seine Steueridentifikationsnummer enthielt. Mein Kind wird also schon mit einem Startgewicht von wenigen Kilos als potenzieller Steuerzahler identifiziert – aber gefördert wird die von uns Eltern und insbesondere Müttern in den ersten Lebensjahren erbrachte Care-Leistung nur mit einem almosenhaft anmutenden einjährigen Elterngeld. All die Kosten und Betreuungszeit, die Kinder selbstverständlich bis zum 18. Lebensjahr verursachen, scheinen reines Privatvergnügen zu sein, denn selbst das Kindergeld dient ja nur der gesetzlich vorgeschriebenen Steuerfreistellung des Kinderexistenzminimums.
Mit etwa 150.000 Euro werden heute die Kosten für ein Kind bewertet – ohne die Betreuungsarbeit als Aufwand zu berechnen. Kein Wunder, dass Kinder zu haben heute mit einem hohen Armutsrisiko verbunden ist. Von der hochgefeierten Mütterrente will ich gar nicht erst anfangen. Sie ist skandalös niedrig, nicht einmal ein Bruchteil einer herkömmlichen Miete für eine Stadtwohnung wird davon bezahlt werden können, und dies, obwohl das Rentensystem so aufgebaut ist, dass die zukünftigen Rentner von meiner Arbeit als Mutter abhängig sind. Somit werden von dieser Politik Mütter und damit Frauen, die all ihre Kraft und ihr Geld in die Erziehung ihrer Kinder stecken, mehr denn je ausgebeutet. Sowohl jetzt als auch später bekommen sie so gut wie keine Anerkennung ihrer Lebensleistung und verarmen spätestens im Alter. Von warmen Worten à la »die Kinder sind unsere Zukunft« kann man sich nichts im Supermarkt kaufen. Deshalb rufe ich es heraus: Keiner soll mehr über zu niedrige Geburtenraten sprechen und gleichzeitig Familien mit Kindern im Regen stehen lassen!
Die häufig zu beobachtende Verwahrung von Kleinkindern in der Kita aufgrund von Personalmangel und schlechten Arbeitsbedingungen ist ein ebensolcher Skandal. Sie wird klaglos hingenommen und sogar noch beschönigend als frühe Bildung verkauft. Traurig genug, dass viele Familien aus existenziellen Gründen auf Fremdbetreuung angewiesen sind und damit gar keine echte Wahlfreiheit haben. Wenn ich aber mit eigenen Augen sehe, wie viel Aufmerksamkeit mein kleiner Sohn verlangt, wie lernbegierig und aufnahmefähig er ist, wie er gerade in diesem jungen Alter mit knapp zwei Jahren alles nachahmt, Wörter nachspricht, Handlungen und den Tonfall imitiert, alles selber machen möchte, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie sich Gleichaltrige in Einrichtungen fühlen. Ständig haben sie ihre Bedürfnisse zurückzustellen, sich anzupassen und einzufügen. Wahrscheinlich ahmen sie auch noch den Stress und die Erschöpfung der Erzieherinnen nach, da sie alles ungefiltert imitieren. Oft wirken ganztags betreute Kleinkinder auf mich matt, gedämpft, das Leuchten in den Augen ist weg. Verschwunden. Um mich nicht falsch zu verstehen: Ich lehne Betreuung durch andere Personen nicht prinzipiell ab. Meine Frage ist vielmehr, warum sich die reguläre Betreuung durch Krippenpersonal und Tagesmütter im wesentlichen nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und nicht nach denen der Kinder richtet?
Ich backe kein Brot, das Bügeleisen bleibt kalt und die Stoffservietten lagern im Schrank. Dennoch habe ich eine zentrale Lektion von meinen Großmüttern und meiner Mutter gelernt: Wie wichtig es für die Kinder ist, einfach da zu sein, ihnen Raum zu geben, Zeit zu haben, so dass sie sich wohlfühlen und sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit entfalten können. Ihnen zu zeigen, dass sie gesehen werden, erweckt und verstärkt ihre Freude am Leben! Die Kinder brauchen liebende Erwachsene, die ihnen ermöglichen, sich und die Welt zu entdecken. Als liebende Mutter begleite und beobachte ich immer wieder staunend, wie sich vor meinen Augen das Wunder wie von selbst entfaltet. Ich gebe ihm Sicherheit, Aufmerksamkeit und Nahrung, seelisch, geistig und körperlich. Das aber erfordert Kraft, Zeit und Ressourcen. Und endlose Geduld. Unter den aktuellen Bedingungen können professionelle Erzieher dies kaum leisten.
Meines Erachtens wird im Moment in großem Stil und in fahrlässiger Weise das unschätzbar wertvolle Potenzial, welches jedes Kind mit sich bringt, verschwendet: Kinder sollen zu allererst einmal nicht stören! Anstatt sich wirklich auf sie einzulassen und ihnen Raum zur Entfaltung zu geben, werden sie im so prägenden Alter zwischen eins bis sechs Jahren weggesteckt, oft nur verwahrt. Im Alltag und im öffentlichen Raum werden sie marginalisiert, nur damit die Erwachsenen von einem Ort zum anderen hetzen, total »busy« sind, was ja soviel heißt, wie »wichtig«, und sich dabei keinen Raum mehr nehmen zum Innehalten und Nachdenken.
Wir verschwenden damit aber nicht nur das Potenzial unserer Kinder und damit der Zukunft unserer Gesellschaft, sondern wir entziehen uns als Eltern gleichzeitig der positiven Kraft der Kinder: Keiner ist derart kompetent, uns einen neuen, achtsamen, freudvollen und zutiefst neugierigen Blick auf die Welt zu schenken, wie ein kleines Kind. Kinder sind im Hier und Jetzt. Ihre Art, diese Welt zu entdecken, ist von Natur aus zutiefst meditativ und ganz auf das konzentriert, was sie gerade tun. Ja, Kinder machen alles langsamer und ganz und gar anders, als wir ach so erfahrenen Erwachsenen! Doch im Beobachten und Uns-selbst-Zurücknehmen können auch wir wieder mehr in die Gegenwart kommen und die Freude an den Wundern der Welt entdecken. Das Wunder steckt im kleinsten Krokus, in der den Weg kreuzenden einsamen Ameise und auch im erstmals selbst zugeknöpften Knopf des Schlafanzuges. »Lass mir Zeit, es selbst zu tun«, ist nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns Erwachsene die unbedingte Chance, das Glück des Augenblickes zu erfahren und wieder zu lernen, glücklich zu sein und zwar nur aus dem Grund, weil wir leben und die Welt mit all unseren Sinnen erfassen können. Wer wollte dieses Glück delegieren?!