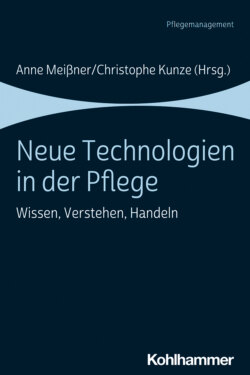Читать книгу Neue Technologien in der Pflege - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Teil IV: Reflektiert handeln: Neue Aufgaben und Handlungsfelder
ОглавлениеDie digitale Transformation führt schon heute zu starken Veränderungen in der Pflege und damit auch zu neuen Anforderungen an Pflegende. Dabei geht es bei weitem nicht nur um die Bedienung und Nutzung von technischen Systemen. Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einem reflektierten Umgang mit technischen Systemen bei der Gestaltung von Pflege. Mit der Digitalisierung werden sich Aufgabenbereiche verändern, neue kommen hinzu. Perspektivisch werden neue berufliche Rollen von Pflegenden entstehen. Dieser Buchteil beleuchtet daher ausgewählte Aufgabenbereiche, die im Kontext neuer Technologien auf Pflegende zukommen.
Zwar haben alle Beiträge dieser Edition ethische Überlegungen nicht gänzlich außen vorgelassen. Petersen und Manzeschke ( Teil IV, Kap. 1) widmen sich im ersten Beitrag des vierten Abschnitts exklusiv den wichtigen Aspekten der sozialen Akzeptanz und ethischen Angemessenheit. Übergreifend stellen sie die Frage, welchen Beitrag Technik zum guten Leben und insbesondere zur guten Pflege leisten kann. Sie differenzieren dazu einerseits den in vielen Beiträgen dieser Edition gebräuchlichen Begriff der Akzeptanz und zeigen nachvollziehbar auf, dass soziale Akzeptanz technischer Systeme nicht allgemein betrachtet werden kann, sondern kontextspezifisch einzubetten ist. Anderseits verweisen sie auf den Begriff der ethischen Angemessenheit und Probleme, die mit der ethischen Urteilsbildung verbunden sind. Sie reflektieren konfligierende Werte, stellen ethische Aspekte in den Kontext der politischen Dimension und erläutern das MEESTAR Modell zur ethischen Evaluation von sozio-technischen Arrangements. In diesen ethischen Diskurs betten sie abschließend Überlegungen zum Beitrag von Technik zur guten Pflege ein.
Moeller-Bruker, Pfeil und Klie ( Teil IV, Kap. 2) stellen ebenfalls ethische Implikationen im Kontext der Technikgestaltung und der Techniknutzung in der Pflege in den Mittelpunkt ihres Beitrags. Am Beispiel von Trackingtechnologien für den Umgang mit sog. Wandering von Menschen mit Demenz zeigen Sie auf, wie Techniknutzung pflegerische Tätigkeiten definiert und welche Rolle dabei bereits in der Entwicklungsphase in die Technik eingeschriebene Wertvorstellungen und Rollenbilder spielen. Damit lenken sie den Blick auf die Bedeutung ethischer Reflexion und Evaluation im Alltag der beruflichen Pflege. Am Beispiel des Einsatzes von Trackingsystemen bei Wandering stellen Sie dar, wie eine Analyse ethischer und sozialer Implikationen beim reflektierten Technikeinsatz in der Pflege durchgeführt werden kann.
Althammer ( Teil IV, Kap. 3) macht das oftmals als trocken erlebte Thema Datenschutz schmackhaft und setzt dieses in einen konkreten Bezug zum pflegerischen Versorgungsalltag. Einleitend zeigt er mit dem Einzug neuer Technologien zusammenhängende wichtige Fragen im Datenschutz auf. Der neue Wert von Daten wird durch den Autor nachdrücklich dargestellt. Im Folgenden hebt der Autor praxisnah wichtige Aspekte hervor, die Datenschutz verstehbar und für den Versorgungsalltag gestaltbar machen. Er zeigt anhand nachvollziehbarer Beispiele auf, wie die wachsende Komplexität und zunehmende Heterogenität unserer Netzwerke zu einem deutlichen Anstieg möglicher Angriffsmuster auf die IT-Sicherheit in Pflege und Gesundheitswesen führen. Gleichzeitig hebt er unmissverständlich das vielfach angebrachte Argument, man habe nichts zu verstecken, aus den Angeln und zeigt damit verbundene Gefahren auf. Er erörtert übersichtlich und für den Laien nachvollziehbar datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen genauso wie Anforderungen, die sich in Hinblick auf die Sicherheit und Verfügbarkeit der Systeme ergeben. Eine Management-Checkliste komplettiert den Beitrag und macht ihn direkt nutzbar.
Meißner und Herzog ( Teil IV, Kap. 4) eröffnen das recht neue Thema des Digitalen Nachlasses. Sie zeigen auf, dass die Regelungen rechtlicher, finanzieller und sozialer Fragen mit zu den wichtigsten Bedürfnissen sterbender Menschen zählen und durch die Digitalisierung zu unserem leiblichen Leben das digitale Leben nun noch dazu kommt. Der Beitrag widmet sich den Fragen und Herausforderungen, die mit diesem neuen Feld einhergehen. Praxisnahe Fallbeispiele verdeutlichen die Relevanz. Gleichzeitig zeigt das Zusammenspiel pflegerischer und rechtlicher Perspektiven und Fragen die Herausforderungen im Versorgungsalltag auf. Ein Blick auf die gesundheitliche Vorsorgeplanung im Allgemeinen und § 132g SGB V im Besonderen fügt den Digitalen Nachlass in bestehende Regelungen und Vorgehensweisen ein. Der Beitrag macht insgesamt deutlich, was dies für die berufliche Pflege bedeutet und warum das Thema für beruflich Pflegende relevant ist. Das Autorinnenteam zeigt eindrücklich, dass der Zusammenhang von leiblichem und digitalem Wohl (am Lebensende) nicht trivial ist. Es wird deutlich, dass das Thema zunehmend an Relevanz gewinnen wird.
Der Beitrag von König und Kunze ( Teil IV, Kap. 5) widmet sich der Technikberatung von Pflegebedürftigen sowie deren An- und Zugehörigen. Fehlende Informations- und Beratungsangebote sowie mangelnde Unterstützung bei der Technikaneignung stehen einer erfolgreichen Nutzung hilfreicher Technik in der häuslichen Versorgung oftmals im Weg. Ausgehend von Erfahrungen aus der Begleitung kommunaler Beratungsangebote stellen die Autoren typische Aufgaben und Instrumente im Beratungsprozess vor. Dabei geben sie Hinweise zum Aufbau von lokalen Beratungsangeboten und stellen dazu verschiedene Praxisbeispiele zu möglichen Beratungsstrukturen vor.