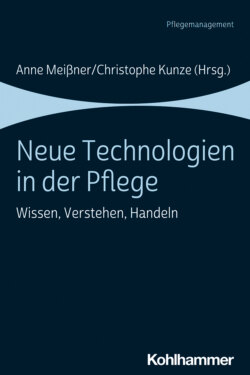Читать книгу Neue Technologien in der Pflege - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2 Digitaler Wandel als Alltagsphänomen
ОглавлениеTechnik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unterschiedlichste technische Systeme haben Einzug gehalten. Einige fallen als solche gar nicht mehr auf, z. B. das Smartphone. Anderen blicken wir gespannt entgegen, z. B. Mixed Reality und den dazu gehörenden Brillen. Soziale Netzwerke kommen und gehen, einige bleiben. In unterschiedlichem Maß, wollen, brauchen und nutzen wir sie. Die mit dem Wandel einhergehende digitale Verfügbarkeit hat ganze Branchen auf den Kopf gestellt. Und wie es der Soziologe Hartmut Rosa auf den Punkt gebracht beschreibt: Sie verändern unser Beziehungs-, Zeit- und Raumgefüge fundamental (Rosa 2005). So buchen wir bargeldlos mit einer Regional-App ein S-Bahn-Ticket, eine Übernachtung im Wellnesshotel, bei Unbekannten auf dem Sofa oder den Flug auf die andere Erdhalbkugel. Wünschen wir uns die Zeit zu vertreiben, streamen wir die Musik, die gerade in unser Lebensgefühl passt. Dating-Apps umschmeicheln unser Beziehungsgefüge. Alexa, Cortana oder Siri dienen uns im derzeit möglichen Rahmen und in virtuellen Welten können wir sein, wer immer wir wollen. Seit COVID-19 lernen und lehren wir dazu digital und bestellen und bezahlen vermehrt online oder persönlich und bargeldlos, bisweilen sogar beim Bäcker um die Ecke. Und auch, wenn sich einiges mit der Bewältigung von COVID-19 vermutlich wieder ändern wird, nimmt die Nutzung technischer Systeme in unserem Alltag insgesamt und stetig zu. Die Welt und Deutschland sind digital in Bewegung. COVID-19 hat diesen Prozess dynamisch beschleunigt.
Die fundamentale Bedeutung des digitalen Wandels beruht jedoch weniger auf digitalen Geräten und Diensten, sondern vielmehr in den gesellschaftlichen Veränderungen, die mit Ihrer Nutzung einhergehen. Die Verfügbarkeit digitaler Anwendungen gibt uns neue Handlungsoptionen und verändert so indirekt unseren Alltag. Mit veränderten individuellen Gewohnheiten gehen auch Veränderungen in Unternehmen und Institutionen einher, die mitunter ganze Branchen umkrempeln. Beispiele dafür finden sich u. a. im Buchmarkt (Amazon), im Transportwesen (Uber), in der Reisevermittlung (Airbnb) oder auch im Finanzwesen (Fintech-Unternehmen). Im Gesundheitswesen sind solche sog. disruptiven Entwicklungen bisher ausgeblieben, was u. a. mit hohen Anforderungen an gesundheitsbezogene Dienstleistungen z. B. in Bezug auf den Datenschutz (vgl. Althammer; Teil IV, Kap. 3) und einer starken (i. d. R. nationalen) Regulierung zusammenhängt. Dennoch zeichnen sich auch hier tiefgreifende Änderungsprozesse ab, etwa durch Videokonsultationen (vgl. Lindwedel; Teil II, Kap. 3), durch sog. Gesundheits- und Medizin-Apps (Kramer et al. 2019) oder durch den im Rahmen des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) geplanten Anspruch auf eine elektronische Patientenakte.
Mit den genannten Veränderungen auf individueller und institutioneller Ebene ist daneben ein tiefgreifender Wandel auf gesellschaftlicher Ebene verbunden, der auch hier vielfältige Fragen aufwirft: Wie lässt sich etwa das Urheberrecht auf neue Mediendienste übertragen? Wie verändern digitale Dienste unsere Privatsphäre? Inwiefern bedrohen soziale Netzwerke, sog. Fake-News, die demokratische Meinungsbildung? Brauchen wir ethische Leitplanken für Algorithmen und wenn ja, wie lassen sich diese gestalten?