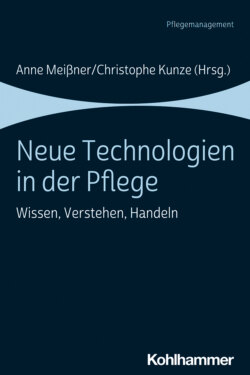Читать книгу Neue Technologien in der Pflege - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Vorwort Anne Meißner & Christophe Kunze
ОглавлениеDie Digitalisierung und Technisierung des Privaten wie Beruflichen ist in aller Munde. Die verwendeten Begrifflichkeiten sind je nach Blickwinkel unterschiedlich. Die einen sprechen von Technik, Technologie, Technisierung oder Digitalisierung. Wieder andere verwenden Begriffe wie disruptive Innovation oder Zukunftstechnologien. Die einen zeichnen ein warmes und freundliches Bild der Zukunft, die anderen werfen ein bedrohliches Szenario in düsteren Farben auf. Aber wie auch immer man es benennt oder betrachtet, die Entwicklung schreitet unaufhörlich voran und findet sich auf allen Ebenen: Digitalisierung verändert die Lebenswelt und das Verhalten von Individuen. Wir kommunizieren mit Freunden und Kollegen über Messengerdienste, machen »Selfies« mit dem Handy, kaufen online ein, viele Menschen lernen sogar ihre Partner online kennen. Auf der Mesoebene verändert Digitalisierung die Organisation von Prozessen in den Institutionen und krempelt ganze Wirtschaftszweige um, wie etwa den Buchhandel, die Reisevermittlung oder das Bankwesen. Und auch der Blick auf die Gesellschaft (Makroebene) zeigt Veränderungen. Diese werden z. B. bei der Diskussion um die Gefahren von »fake news« in sozialen Medien für die Demokratie oder bei der Suche nach ethischen Leitplanken für selbstfahrende Autos deutlich.
Gleichzeitig schreitet sie unterschiedlich eilig voran. Einzelne Branchen nutzen die Digitalisierung schneller und besser als andere. Das Gesundheitswesen zeigt sich eher gemächlich. Und nicht alle Menschen profitieren von Digitalisierung in gleichem Maße. Eine »digitale Kluft« tut sich auf. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einigen widmen sich die Beiträge dieses Buches.
Insgesamt fordern die bekannten demografischen, epidemiologischen und gesellschaftlichen Veränderungen dazu auf, Lösungen zu finden. Allerdings geht es nicht darum, irgendeine Lösung für die derzeitigen oder zukünftig zu erwartenden Probleme zu finden. So sind z. B. technische »Waschstraßen« für Menschen in Krankenhäusern analog zu Autowaschstraßen zwar faktisch eine Lösung für das Fehlverhältnis von Angebot und Nachfrage in der beruflichen Pflege. Es wäre technisch möglich. Gleichzeitig stimmt dieses Bild nicht mit dem Verständnis einer würdevollen Pflege überein. Es gilt also vielmehr, einen Weg zu finden, den Herausforderungen auf wohlgesonnene Weise zu begegnen und lebensdienliche Vorgehensweisen mit oder ohne Technik zu gestalten, die sowohl gesellschaftlich akzeptiert, bezahlbar und auch umsetzbar sind. Die Digitalisierung mit ihren innovativen technischen Systemen eröffnet grundsätzlich solch einen Lösungsweg. Schließlich können neue Technologien ein Weg sein, um zukünftige Herausforderungen in der pflegerischen Versorgung und Betreuung zu bewältigen. Gleichzeitig ist Technik nicht immer die beste Lösung. Daneben ist das Konzept von Würde und die Vorstellung, was eine würdevolle pflegerische Versorgung ausmacht, in den kulturellen Kontext zu betten und damit wandelbar.
Sicher ist, dass der Einsatz neuer Technologien den pflegerischen Versorgungsalltag verändern wird. Das ist auf der einen Seite erklärtes Ziel. Wir wollen Problemlösung und damit Veränderung. Wie Albert Einstein eindrücklich und unmissverständlich formulierte, ist die reinste Form des Wahnsinns, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, das sich etwas ändert. Es gilt also, etwas zu ändern und nicht zu erwarten, dass alles bleibt wie es ist.
Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass die Digitalisierung und damit zusammenhängende Veränderungsprozesse komplex sind und weit mehr als nur die Entwicklung neuer Technologien bedingen. Auch von der Funktionalität her einfach erscheinende digitale Technologien können eine enorme Komplexität aufweisen, die sich z. B. aus Gründen der IT-Sicherheit, der Skalierbarkeit, der langfristigen Wartbarkeit oder aus Abhängigkeiten von anderen Systemen ergeben können. Aber die Entwicklung funktionierender technischer Lösungen ist nur der eine (und oft leichtere) Teil der Arbeit. Die Möglichkeiten technischer Systeme ausgehend von Bedürfnissen und Bedarfen neu zu denken, diese interdisziplinär zu gestalten, umfänglich auszuschöpfen und so lebensdienliche Technik für Menschen zu entwickeln, die sich in menschliche Prozesse einfügt (und nicht umgekehrt) – das ist die hohe Kunst!
Wenn technische Systeme wirksam und nachhaltig Einzug in die pflegerische Versorgungswelt halten sollen, dann muss der Ausgangspunkt für Entwicklung, Erprobung, Implementierung und Bewertung der Versorgungsauftrag und die Bedürfnis- und Bedarfslage betroffener Zielgruppen sein. Diesen Fokus wirkungsvoll zu setzen, kann nur gelingen, wenn Pflegende sich entschlossen mit den neuen Möglichkeiten beschäftigen.
Gleichzeitig ist zu betonen, dass alles rund um die Entwicklung, Erprobung, Implementierung und Bewertung neuer Technologien interdisziplinär und partizipativ zu betrachten ist. Schließlich gilt, sich aus verschiedenen Perspektiven anzunähern, die effektive und effiziente Erfüllung des Versorgungsauftrags im Blick zu haben und umfassend den eigenen Gegenstandsbereich zu vertreten, um dadurch umfassende und wünschenswerte Lösungen zu finden. Damit dies gelingen kann, ist eine vertiefende Auseinandersetzung für alle im Gesundheitswesen Beteiligten nicht nur erforderlich, sondern geboten.
Derzeit sprießen Publikationen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, so scheint es, wie Pilze aus dem Boden. Der vorliegende Band fokussiert auf den pflegerischen Versorgungsalltag. Gleichwohl gibt es weit mehr Themen, die es zu behandeln gälte. Allerdings ist solch ein Projekt immer einzugrenzen und es gilt, den Ausgangspunkt zu definieren. Für den einen mag das zu viel, für den anderen zu wenig sein. Die Frage bleibt: Wovon gehen wir aus, wo fangen wir an? Wir haben uns bemüht, einen Ausgangspunkt zu legen, der vorwiegend in wichtige Aspekte einer neuen Thematik einführt. Gleichzeitig fehlen bereits jetzt relevante Themen, z. B. Mixed Reality oder Gesundheits- und Medizin-Apps (siehe dazu auch Besonderheiten rund um COVID-19). Die Kernmessage ist: Es gibt noch weit mehr zu sagen. Dieses Buch ist ein guter Anfang für eine erste Auseinandersetzung.
Mit dieser Edition rufen wir dazu auf, sich aktiv mit der Thematik auseinanderzusetzen, in die neue Themenwelt einzutauchen, zugleich offen und kritisch für Veränderungen zu sein und dabei den pflegerischen Gegenstandsbereich und »pflegerischen Blick« als Perspektivschirm zu spannen.
Das Herausgeberteam selbst ist interdisziplinär aufgestellt. So ist einerseits praktische Pflegeerfahrung in Verbindung mit Pflegewissenschaft und andererseits eine technikwissenschaftliche Perspektive vertreten. Die Autorinnen und Autoren vervollständigen die Interdisziplinarität, und machen »ein Ganzes« draus. So sind Pflegende aus Wissenschaft und Praxis vertreten, genauso wie juristische oder gerontologische Kolleginnen und Kollegen oder Kolleginnen und Kollegen mit Schwerpunkt Informatik.
Die Realisierung eines solch umfangreichen Projekts bedarf der vertrauensvollen und verbindlichen Zusammenarbeit. Für dieses erfolgreiche – und in Corona-Zeiten besonders wichtig –, auch freudvolle Zusammenwirken möchten wir uns bei allen Autorinnen und Autoren herzlichst bedanken. Bleiben Sie gesund!
Hildesheim, im Mai 2020
Anne Meißner
Furtwangen, im Mai 2020
Christophe Kunze