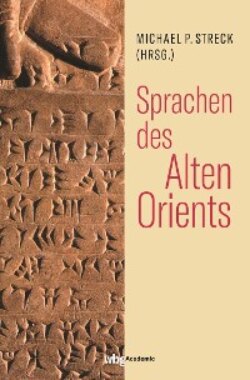Читать книгу Sprachen des Alten Orients - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. SCHREIBTECHNIK
ОглавлениеKeilschrift wurde von Hause aus auf und mit Materialien geschrieben, die besonders in Mesopotamien in nahezu unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen: Ton9 und Schilfrohrgriffel.10 Der Ton wurde meist zu kleinen Tafeln geformt (vgl. Abb. 1), die sumerisch dub genannt wurden; das Wort wurde in das Akkadische als tuppu und von dort in weitere altorientalische Sprachen entlehnt.11 Der Schreibgriffel hieß sumerisch gi dub-ba, akkadisch qan tuppi, wörtlich „Schilfrohr der Tafel“. Er konnte aber auch aus Holz und Knochen bestehen. Götter und Herrscher bedienen sich beim Schreiben wertvoller Materialien wie Edelmetall oder Edelstein. Der Griffel konnte in einem Behältnis aus Holz, Leder oder Schilfrohr aufbewahrt werden.
Abb. 1: Keilschrifttontafel, Rückseite, Ur III-Zeit, 21. Jahrhundert v. Chr., Altorientalisches Institut der Universität Leipzig, SIL 92 = LAOS 1, 25.
Die große Mehrzahl von Tontafeln ist rechteckig im Längs- oder Querformat.12 Ihre Größe variiert von ganz kleinen, perlenartigen Stücken von 0,8 x 0,8 cm zu großen Texten bis zu 45 x 30 cm. Die mittlere Größe rechteckiger Tafeln ist etwa 10 x 7 cm. Altbabylonische und ältere Schülertafeln, manchmal auch Tafeln anderen Inhalts, sind gerne rund, vermutlich, weil die Kinderhand sie leichter als eine rechteckige Tafel halten konnte. Nicht nur die Größe der Tafeln, sondern auch die der Schrift variiert. Bei einem altbabylonischen Brief beträgt die durchschnittliche Höhe der Keilschriftzeichen 4–5 mm. Es gibt aber auch Tafeln mit kleineren Schriftzeichen.
Meist werden Vorder- und Rückseite einer Keilschrifttafel beschrieben. Dabei wird die Tafel normalerweise nicht wie eine Buchseite umgewendet, sondern um ihre untere Achse gedreht. Es gibt in allen Perioden die Tendenz, dass die Vorderseite der Tafel flach ist und die Rückseite konvex. Der Grund dafür ist vermutlich, dass der Schreiber, wenn er die Rückseite beschrieb, die Tafel auf die Vorderseite legte und dadurch etwas flach drückte; das gilt besonders für große, schwere Tafeln. Der rechte Tafelrand wurde oft beschrieben, wenn die Zeile nicht ausreichte, der linke blieb dagegen frei oder enthielt lediglich die letzten Zeilen des Textes. Auch der untere und obere Rand konnten beschrieben werden. Größere Tafeln enthalten Kolumnen wie unsere Zeitungen, die auf der Vorderseite von links nach rechts, auf der Rückseite dagegen von rechts nach links angeordnet sind. Die Zahl der Kolumnen reicht von zwei, wie etwa häufig bei zweisprachigen lexikalischen Texten, bis zu Tafeln mit sechs und mehr Kolumnen pro Seite.
Eine bedeutende Entwicklung beim Beschreiben der Tontafel ist die Änderung der Schriftrichtung im Verlauf des 3. Jahrtausends. Man hat beobachtet, dass die ältesten, noch bildhaften Formen mancher Zeichen, etwa Fisch, Vogel, Rinderkopf, um 90° nach rechts gedreht werden müssen, damit die Bilder erkennbar sind. Oder anders gesagt: die Zeichen wurden im Lauf der Schriftgeschichte aus ihrer ursprünglichen Position um 90° nach links gedreht.13 Bis etwa 2350, dem Beginn der altakkadischen Periode, wurde in Kästchen geschrieben, die von rechts nach links und in Zeilen untereinander angeordnet waren. Innerhalb der Kästchen war die Zeichenanordnung prinzipiell frei und folgte dem verfügbaren Platz. Ab etwa 2350 wird der Text von links nach rechts gelesen und die Kästchen werden zugunsten von Zeilen aufgegeben. Während für Tontafeln der Wechsel der Schriftrichtung bereits um 2350 erfolgte, konnten Monumente noch ein paar Jahrhunderte länger in der archaischen Schriftrichtung beschrieben und anscheinend auch gelesen werden. Berühmtes Beispiel dafür ist der Kodex Hammurapi aus der Zeit um 1750, in dem der Text senkrecht in von rechts nach links angeordneten Kolumnen angebracht ist. Die Zeichen wurden in den Zeilen in der Reihenfolge ihrer Lesung geschrieben, allerdings meist ohne Worttrenner; nur in altassyrischen Texten kommt oft ein kleiner senkrechter Keil als Worttrenner vor. In literarischen und wissenschaftlichen Texten, nicht jedoch in anderen Textgenres, deuten gelegentlich Abstände zwischen Zeichengruppen die Wortgrenzen an.
Während man im ältesten Stadium der Schrift den Griffel in den feuchten Ton ritzte und auf diese Weise noch vielfach bildhafte Zeichen auch mit runden Linien erzielte, ging man bald dazu über, letztere der Einfachheit halber durch gerade Striche zu ersetzen. Noch schneller als Ritzen und die Entstehung von Tonwülsten vor dem Griffelkopf vermeidend war es jedoch, den Schreibgriffel in den Ton zu drücken;14 durch den Querschnitt des aus dem Rohr geschnittenen Griffels entstand das typische keilförmige Grundelement der Keilschriftzeichen. Die Zeichen, die zu Beginn aus noch zahlreichen und in verschiedenen Richtungen angeordneten Keilen bestanden, wurden im Verlauf der paläographischen Entwicklung teilweise vereinfacht, wobei auch zahlreiche regionale Ausprägungen der Keilschrift entstanden (Abb. 2).15
Abb. 2: Beispiele für regionale und chronologische Varianten von Keilschriftzeichen
Neben Tontafeln gibt es auch andere Schriftträger aus Ton. Mengenmäßig am bedeutendsten sind Ziegel, auf denen eine kurze Bauinschrift entweder per Hand, überwiegend aber per Ziegelstempel angebracht wurde. Für monumentale Texte, für lexikalische Texte und auch für manche literarische Texte gab es große Tonzylinder oder Tonprismen, die öffentlich zur Schau gestellt waren. Tonnägel enthalten in der Hauptsache Bauinschriften; sie wurden in die Mauer eingelassen und dokumentierten die Übereignung des Gebäudes durch den Herrscher an die Gottheit.
Der an der Luft getrocknete Ton ist ein recht unverwüstlicher Beschreibstoff. Er ist der Grund dafür, dass aus dem Alten Orient im Gegensatz zu manchen anderen alten Schriftkulturen mit anderen Beschreibunterlagen eine große Fülle von Original-Schriftzeugnissen überliefert ist. Noch dauerhafter sind gebrannte Tafeln, die als Gründungsbeigaben oder für offizielle Bibliotheken bestimmt waren. Manche Tontafeln wurden auch durch eine Feuersbrunst sekundär gebrannt.
Neben Ton gab es allerdings auch andere Schriftträger. Dem Ton am nächsten kommen in seiner Beschaffenheit wachsbeschichtete Holz- oder Elfenbeintafeln, die auf akkadisch lēʾu heißen. Sie konnten aus mehreren Blättern (sumerisch ig bzw. akkadisch daltu „Tür“) bestehen.16 Wachstafeln sind seit dem Ende des 3. Jahrtausends in den Texten belegt, zunächst allerdings eher spärlich, was mit der geringen Verfügbarkeit von Bienenwachs zusammenhängen dürfte. In Mode kamen sie seit dem Ende des 2. Jahrtausends, sind jedoch aufgrund des ungünstigen Klimas Mesopotamiens, in dem sich organische Materialien schlecht über Jahrtausende erhalten, nur in kärglichen Resten bei Ausgrabungen wiederentdeckt worden. Es ist anzunehmen, dass auf Wachstafeln teilweise andere Texte geschrieben wurden als auf Tontafeln; für Verträge waren sie etwa weniger geeignet, da der Text auf einer Wachstafel leichter nachträglich geändert werden konnte als auf einer Tontafel. Belegt sind in den Texten z. B. Wachstafeln mit umfangreichen literarischen Texten wie etwa der astrologischen Omenserie „Als Anu (und) Enlil“ oder Abschnitten des Gilgamešepos; andere enthielten Teile der Korrespondenz der assyrischen Könige mit babylonischen Gelehrten (7. Jahrhundert) oder administrative Texte (ab dem 6. Jahrhundert).
Ein weiterer Beschreibstoff war Stein. Könige ließen Inschriften an Felswänden anbringen. Landschenkungsurkunden wurden auf steinerne Stelen gemeißelt. Statuen, Reliefs, Türangelsteine, Gewichte, Weihplatten und Gefäße wurden beschriftet. Die Schriftform auf Steinmaterialien weicht in der Regel von der Form auf Tontafeln ab und ist weniger kursiv. Steininschriften wurden vielleicht von schriftunkundigen Steinmetzen geschrieben, die nach Vorlage arbeiteten.
Selten sind Inschriften auf Metall wie etwa metallenen Tafeln für Königsinschriften oder Staatsverträge, Waffen oder Bronzestatuen.