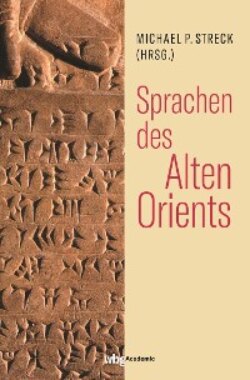Читать книгу Sprachen des Alten Orients - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bibliographie
Оглавление| Borger, R. | ||
| 2010 | Mesopotamisches Zeichenlexikon = AOAT 305. | |
| CDLI | Cuneiform Digital Library Initiative. https://cdli.ucla.edu. | |
| Edzard, D. O. | ||
| 1976–80 | Keilschrift, RlA Bd. 5, 544–568. | |
| 2003–05 | Orthographie. A. Sumerisch und Akkadisch bis einschl. Ur III-Zeit, RlA Bd. 10, 132–136. | |
| Englund, R. | ||
| 1998 | Texts from the Late Uruk Period, OBO 160/1, 13–233. | |
| Geller, M. | ||
| 1997 | The Last Wedge, ZA 87, 43–95. | |
| Hasselbach, R. | ||
| 2005 | Sargonic Akkadian. Wiesbaden. | |
| Hecker, K. | ||
| 1968 | Grammatik der Kültepe-Texte = AnOr. 44 | |
| HPM | Hethithologie Portal Mainz. https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.php | |
| Hoffner, A. H. und H. C. Melchert | ||
| 2008 | A Grammar of the Hittite Language. Winona Lake. | |
| Jagersma, A. H. | ||
| 2010 | A Descriptive Grammar of Sumerian. Leiden. | |
| Keetman, J. | ||
| 2020 | Sumerisch auf Tafeln der Schriftstufe Uruk III, in: I. Arkhipov/L. Kogan/N. Koslova (ed.), The Third Millennium. Studies in Early Mesopotamia and Syria in Honor of Walter Sommerfeld and Manfred Krebernik (Leiden/Boston) 341–376. | |
| Krebernik, M. | ||
| 1985 | Zur Entwicklung der Keilschrift im III. Jahrtausend anhand der Keilschrifttexte aus Ebla. Ein Vergleich zwischen altakkadischem und eblaitischem Schriftsystem, AfO 32, 53–59. | |
| 1994 | Rezension zu M. W. Green/H. Nissen, Zeichenliste der archaischen Texte aus Uruk, OLZ 89, 380–386. | |
| 2013 | Die frühe Keilschrift und ihr Verhältnis zur Sprache, in: N. Crüse-mann et alii (ed.), Uruk. 5000 Jahre Megacity (Berlin) 186–193. | |
| Krebernik, M. und H. Nissen | ||
| 1994 | Die sumerisch-akkadische Keilschrift, in: H. Günther/O. Ludwig (ed.), Schrift und Schriftlichkeit 1/1, 274–288. | |
| Labat, R. und F. Malbran-Labat | ||
| 1976 | Manuel d’épigraphie Akkadienne. 5. Auflage. Paris. | |
| Mittermayer, C. | ||
| 2009 | Enmerkara und der Herr von Arata = OBO 239. | |
| Oettinger, N. | ||
| 2003–05 | Orthographie. C. Hethitisch, RlA Bd. 10, 140–143. | |
| Pantalacci, L. | ||
| 2013 | Archivage et scribes dans l’oasis de Dakhla (Égypte) à la fin du IIIe millénaires, in: L. Pantalacci (ed.), La lettre d’archive. Communication administrative et personelle dans l’antiquité proche-orientale et égyptienne (Kairo 2008) 141–153. | |
| Peust, C. | ||
| 2000 | Über ägyptische Lexikographie. 1. Zum Ptolemaic Lexikon von Penelope Wilson, 2. Versuch eines quantitativen Vergleichs der Textkorpora antiker Sprachen, Lingua Aegyptia 7, 245–260. | |
| Powell, M. A. | ||
| 1981 | Three Problems in the History of Cuneiform Writing: Origins, Direction of Script, Literacy, Visible Language 15/4, 419–440. | |
| Röllig, W. | ||
| 1960 | Griechische Eigennamen in Texten der babylonischen Spätzeit, 376–391. | |
| Rüster, C. und E. Neu | ||
| 1989 | Hethitisches Zeichenlexikon = StBoT Bh. 2. | |
| Sallaberger, W. | ||
| 2014–16 | Ton. A. Philologisch, RlA Bd. 14, 89–91. | |
| Schmandt-Besserat, D. | ||
| 1992 | Before Writing. Austin. | |
| 2014–16 | Token, RlA Bd. 14, 87–89. | |
| SEAL | Sources of Early Akkadian Literature. https://seal.huji.ac.il. | |
| Steinkeller, P. | ||
| 1995 | Rezension zu M. W. Green/ H. Nissen, Zeichenliste der archaischen Texte aus Uruk, BiOr. 52, 689–713. | |
| Stève, M.-J. | ||
| 1992 | Syllabaire élamite: histoire et paléographie. Neuchâtel/Paris. | |
| Streck, M. P. | ||
| 2001 | Keilschrift und Alphabet, in: D. Borchers/F. Kammerzell/S. Weninger (ed.), Hieroglyphen, Alphabete, Schriftreformen: Studien zu Multiliteralismus, Schriftwechsel und Orthographieneuregelungen (Göttingen) 77–97 | |
| 2003–05 | Orthographie. B. Akkadisch im II. und I. Jt., RlA Bd. 10, 137–140. | |
| 2011–13 | Syllabar, RlA Bd. 13, 377–379. | |
| Volk, K. | ||
| 2009–11 | Schreibgriffel, RlA 12, 280–286. | |
| Volk, K. und U. Seidl | ||
| 2014–16 | Wachstafel. A. In Mesopotamien, RlA Bd. 14, 609–613. | |
| von Soden, W. und W. Röllig | ||
| 1991: | Das akkadische Syllabar (= AnOr. 42). 4. Auflage. | |
| Waal, W. J. I. | ||
| 2014–16 | Wachstafel. B. Bei den Hethitern, RlA Bd. 14, 613f. | |
| Walker, C. B. F. | ||
| 1990 | Cuneiform, in: Reading the Past. Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet (Berkeley) 14–73. | |
| 2014–16 | Tontafel, Tontafelhülle, RlA Bd. 14, 101–104. | |
| Wilcke, C. | ||
| 2005 | ED Lú A und die Sprache(n) der archaischen Texte, in: W. H. van Soldt, in cooperation with R. Kalvelagen and D. Katz (ed.), Ethnicity in Ancient Mesopotamia (2005) 430–445. |
1 Joseph und seine Brüder, Vorspiel: Höllenfahrt, Kapitel 3.
2 Überblicksdarstellungen sind z. B. Walker 1990; Krebernik/Nissen 1994.
3 Auch wenn die ältesten Keilschrifttexte noch nicht voll deutbar sind, sind die Zweifel, ob die älteste in ihnen wiedergegebene Sprache tatsächlich Sumerisch und nicht eine uns unbekannte Sprache (oder gar mehrere Sprachen) ist (vgl. etwa Englund 1998, 73–81), wenig berechtigt. Vielmehr verdichten sich die Anhaltspunkte für Sumerisch immer mehr, vgl. z. B. Krebernik 1994: 384; Steinkeller 1995: 694f.; Wilcke 2005; Krebernik 2013: 189f.; Keetman 2020.
4 Hier gebrauchte man die minoischen Schriften Linear A und Linear B.
5 In Ägypten verwendete man seit dem Ende des 4. Jahrtausends die ägyptische Hieroglyphenschrift. Welche der beiden Schriften älter ist, Keilschrift oder Hieroglyphenschrift, lässt sich nicht sicher beantworten. Tontafeln aus Balat (Daḫla) mit hieratischer Schrift aus dem Ende des 3. Jahrtausends (vgl. Pantalacci 2013) dürften eine Kenntnis der Keilschrift in Ägypten zu dieser Zeit voraussetzen. Während die Keilschrift Vokale wiedergibt, ist die ägyptische Schrift vokallos, weshalb sie, anders als die Keilschrift, nie auf andere Sprachen übertragen wurde, sondern auf den ägyptischen Kulturkreis beschränkt blieb.
6 Für das Ende der Keilschrift vgl. Geller 1997.
7 Vgl. für den Text Mittermayer 2009: 144f. Z. 501–506; ebd. S. 62–66 diskutiert sie den Passus zur Schrifterfindung. Obige Übersetzung folgt ihr jedoch nicht in der Lesung „wie ein Siegel“ (kišib) statt „wie auf eine Tafel“ (dub): der Vergleich ist ja nicht anachronistisch, sondern impliziert die Miterfindung des Schriftträgers; Keilschrift und Tontafel sind, auch wenn es mitunter andere Schriftträger gab, unlösbar miteinander verbunden.
8 Schmandt-Besserat 1992; 2014–16.
9 Zur Verwendung von Ton für Tontafeln vgl. Sallaberger 2014–16: 91 § 3.4.
10 Zum Schilfrohrgriffel vgl. Volk 2009–11.
11 Neben dem allgemeinen dub/tuppu gibt es zahlreiche weitere Wörter, die meist bestimmte Typen von Tontafeln bezeichnen und deren Gebrauch z. T. regional und chronologisch beschränkt ist, z. B. im Akkadischen egertu (neuassyrisch) „Brief“, giṭṭu (spätbabylonisch) „einkolumnige Tafel, Quittung“, kiṣirtu (neuassyrisch) „Tafel mit Tafelhülle“, kunukku „gesiegelte Tafel“, ṣeʾpu (altbabylonisch) „gesiegelter Brief“, tuppu ḫarmu (altassyrisch) „Tafel mit Hülle“, unnedukku (altbabylonisch) „Brief“.
12 Zu den Größen, Formen und Ausgestaltungen von Tontafeln vgl. Walker 2014–16.
13 Zu den Gründen für diesen Schriftrichtungswechsel vgl. Powell 1981: besonders S. 424–431.
14 Keilschrift wird nicht in Ton „gemeißelt“, wie von Fachfremden manchmal angenommen wird.
15 Zur chronologischen Entwicklung und regionalen Differenzierung der Zeichenformen vgl. zusammenfassend Edzard 1976–80.
16 Volk/Seidl 2014–16 für Mesopotamien und Waal 2014–16 für Kleinasien.
17 Zeichennamen werden im folgenden durch Großbuchstaben wiedergegeben.
18 Ausnahmen sind einige Akkadogramme in spätbabylonischen Texten, wie z. B. I-TA-PAL-lu-ʾ für ītaplū, d. h. Schreibung des Singulars I-TA-PAL und Anfügung zweier Zeichen zur Angabe der Pluralendung; vgl. dazu Streck 2003–05: 139f. § 4.6.
19 Eine Liste in hethitischen Texten vorkommender Akkadogramme bieten Rüster/Neu 1989: 362–369.
20 Vgl. Hoffner/Melchert 2008: 21f. für die wenigen neuen Lautwerte der hethitischen Keilschrift.
21 Stève 1992: 17.
22 Das Determinativ dingir vor Götternamen wird dabei zu d verkürzt.
23 Eine Liste der Determinative gibt Labat/Malbran-Labat 1976: 20–22.
24 Die sumerischen Basen sind hier wie Logogramme in akkadischen Texten mit Großbuchstaben wiedergegeben, um die Schreibweise zu verdeutlichen. Tatsächlich vereinfacht hier die wissenschaftliche Umschrift des Sumerischen (vgl. dazu S. 28) und umschreibt auch die logographisch geschriebenen Basen des Sumerischen mit Kleinbuchstaben.
25 Das Sumerische kennt in bestimmten Texten eine rein phonographische Schreibweise; dazu Edzard 2003–05: 135f.
26 Das akkadische Syllabar ist umfassend behandelt bei von Soden/Röllig 1991.
27 Krebernik 1985: 57; Hasselbach 2005: 95.
28 Krebernik 1985: 56. Auch die altakkadische Evidenz spricht für EN als KVK-Zeichen, vgl. Hasselbach 2005: 67.
29 Vgl. die Standard-Zeichenliste für das Akkadische, Borger 2010.
30 Zum altassyrischen Zeichenbestand vgl. Hecker 1968 § 5.
31 Rüster/Neu 1989. Für Elamisch, Hurritisch und Urartäisch vgl. die Zusammenfassung in Streck 2011–13: 381.
32 Edzard 2003–05: 133f.
33 Streck 2001: 78f.; 2003–2005: 139f.
34 Zum Sumerischen vgl. Jagersma 2010: 62. Dort wird auch die mögliche Ausnahme ĝešd „sechzig“ besprochen.
35 Oettinger 2003–2005: 141.
36 Röllig 1960: 383f.
37 In der Frühzeit der Altorientalistik wurden statt der Handkopie bisweilen mit Lettern gedruckte „Kopien“ hergestellt.