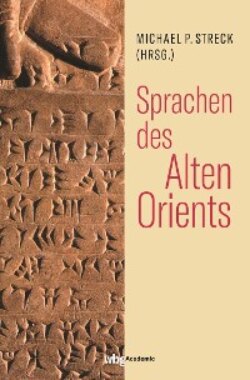Читать книгу Sprachen des Alten Orients - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. PUBLIKATION VON KEILSCHRIFTTEXTEN
ОглавлениеAltorientalisten verwenden bei der Publikation von Keilschrifttexten zwei Techniken: die bildliche Wiedergabe der Keilschrift und die Umschrift der Keilschrift.
Die bildliche Wiedergabe der Keilschrift erfolgt meist entweder im Foto und/oder in der Autografie bzw. Handkopie.37 Digitale Fotografie erleichtert nicht nur das Arbeiten an den Texten, sondern ist auch eine effektive Methode der Publikation im Internet. So bietet z. B. die Webseite CDLI, der bislang umfangreichste Versuch einer Katalogisierung aller Keilschrifttexte, oft auch digitale Fotos. Dies gilt auch für zahlreiche andere Webseiten beschränkteren Umfangs, etwa die Webseite SEAL für akkadische literarische Texte der älteren Perioden oder HPM für hethitische Texte. Von Hand angefertigte Autographien bieten eine möglichst originalgetreue zweidimensionale Wiedergabe der dreidimensionalen Keilschrift.
Die Polyphonie (Mehrdeutigkeit) der Keilschriftzeichen führte seit Beginn der ersten Editionen von Keilschrifttexten in der Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, Keilschrift in Lateinschrift zu umschreiben, um zu verdeutlichen, welche Lesung der wissenschaftliche Bearbeiter annimmt. Dabei unterscheidet man zwischen Transliteration und (gebundener) Transkription.
Die besonders in Texteditionen verwendete Transliteration gibt Zeichen für Zeichen den Keilschrifttext wieder. Zu einem Wort gehörige Zeichen werden durch Bindestriche (manchmal auch durch Punkte) miteinander verbunden. So wird z. B. die akkadische, phonographische Zeichenfolgemit den Kleinbuchstaben i-lu-um „Gott“ transliteriert. Man differenziert Keilschriftzeichen gleichen phonographischen Wertes durch Akzente oder Indizes, damit die Transliteration genaue Information über das im Keilschrifttext gebrauchte Zeichen enthält. So gibt es z. B. für den Vokal /u/ die drei unterschiedlichen Keilschrifttzeichen oderdie mit u (= u1), ú (= u2) und ù (= u3) transliteriert werden.
Logogramme werden je nach Sprache unterschiedlich transliteriert. In sumerischen Texten werden die meist logographisch geschriebenen Wortbasen (vgl. S. 24) wie phonographische Zeichen mit Kleinbuchstaben wiedergegeben: lugal-e-ne “Könige” statt LUGAL-e-ne. In akkadischen Texten dagegen erscheinen Logogramme in Großbuchstaben oder Kapitälchen mit ihrer sumerischen Lesung: wird LUGAL transliteriert, zu lesen als akkadisch šar-ru “König”. Das gilt auch für hethitische Texte, die aber neben den aus dem Sumerischen übernommen Wortzeichen, den Sumerogrammen, auch noch aus dem Akkadischen entlehnte, die sogenannten Akkadogramme (vgl. S. 22 und 108) kennen, die mit kursiven Großbuchstaben oder Kapitälchen transliteriert werden, z. B. = BE-EL (von akkadisch bēl(u) „Herr“) mit der hethitischen Lesung išḫā-.
Determinative schließlich werden in der Transliteration ebenfalls mit der sumerischen Lesung hochgestellt (manchmal auch auf derselben Zeilenhöhe mit Trennungspunkt): DINGIRmeš oder DINGIR.MEŠ mit der Lesung ilū/ilānū „Götter“.
Die Transkription oder gebundene Umschrift ist eine phonemische Rekonstruktion, d. h. eine Wiedergabe der Lautgestalt des Wortes (wenn auch nicht immer der ganz genauen Aussprache) unabhängig davon, wie es im Keilschrifttext geschrieben wird. Die Transkription wird vor allem in der Grammatik und im Lexikon gebraucht. Die akkadische Zeichenfolge (Transliteration i-lu-um) wird ilum „Gott“ transkribiert. Die Transkription enthält auch Informationen über Vokallängen und Doppelkonsonanzen, die keilschriftlich nicht immer notiert werden: so wird der akkadische Plural (Transliteration i-lu) ilū „Göt-ter“ transkribiert mit einem die Vokallänge bezeichnenden Strich über dem u, und die akkadische Verbalform(Transliteration ḫu-sí-is) erscheint in Transkription als ḫussis „denk nach!“ mit Doppel-ss.