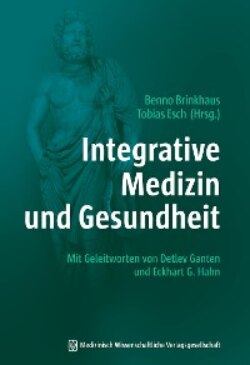Читать книгу Integrative Medizin und Gesundheit - Группа авторов - Страница 29
2.5 Rituale und Selbstheilung in der Medizin
ОглавлениеDie moderne Medizin beginnt mit Hippokrates von Kos (460–371 v.u.Z.) und den Asklepiaden. Schon damals findet sich eine Betonung von Lebensstil bzw. „Lebenskunst“ als wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Heilung. So war Hippokrates’ „Diaita“ weit mehr als eine Ernährungslehre. Es war auch eine Anleitung zur Selbstfürsorge. Ebenfalls wird schon mit der Dreiteilung gearbeitet, die von nun an lange bestimmend in der europäischen Medizin sein sollte: Neben der Chirurgie bzw. dem ärztlichen Eingriff und der Pharmakologie waren Lebensführung und Eigenverantwortung essenzielle Bestandteile nicht nur der Behandlung, sondern eben auch der Gesundheitsversorgung (vgl. Therapeia), Gesundheitsforschung (vgl. Hygieina) und Gesundheitsvorsorge (vgl. Prophylaxis). Interessanterweise spielte, neben der Tugendhaftigkeit, der Kunst und der Wissenschaft, auch die Religion eine wichtige Rolle beim Erhalt der Gesundheit. Lebensziel war u.a. der Erhalt von Ordnung, Ausgleich und Gesundheit. Dieses war eine Frage des systematischen Vorgehens (Wissenschaft), der gemäßigten, geordneten und ausdrucksvollen Lebensweise (Tugend, Kunst) sowie eines frommen oder religiösen Lebens, d.h. des Glaubens – hier v.a. als kulturelles Konstrukt. Selbstverantwortung war ein zentrales Element. In der Philosophie dieser Zeit spiegelten sich jene Auffassungen wider (u.a. bei Aristoteles) (vgl. Esch 2014).
In den folgenden Jahrhunderten tauchte immer wieder die Betonung der Selbstfürsorge im medizinisch-therapeutischen Kontext auf, aber auch im religiösen, denn nach wie vor waren beide Bereiche eng miteinander verbunden. Häufig äußerte sich diese „Synthese“ oder Einbindung im Sinne einer „inneren Kraft zur Heilung“, d.h. unter der Annahme einer Selbstheilungstendenz und -fähigkeit des Menschen. Wir finden eine derartige Komplementarität zwischen der „äußeren Medizin“ (oder Religion) einerseits und der Selbstfürsorge/-heilung (dem „inneren Arzt“) andererseits u.a. bei Galen im 3. Jahrhundert (vgl. van der Eijk 2011). Dieser orientierte sich an Hippokrates und Aristoteles und zeichnete eine Medizin vor, die davon ausging, dass Gesundheit – und nicht Krankheit – der Normalzustand sei (der Mensch also von Natur aus „gesund“) und dass funktionale Zusammenhänge und innere Regulationsprozesse zu beachten seien, welche prinzipiell die Tendenz zur Heilung hätten, d.h. zum „inneren Gleichgewicht“ führten. Der Arzt war in diesem Kontext mehr Unterstützer und Ermöglicher als eigentliches „Pharmakon“ oder „Agens“ – Medizin bedeutete, dass der Therapeut bzw. Behandler mit der Natur zusammenzuarbeiten hatte. Der Einzelne hatte in hohem Maße Einfluss auf die Gesundheit. Ähnliches finden wir später bei Paracelsus (vgl. Esch 2014) im 16. Jahrhundert, der u.a. das Zusammenspiel zwischen dem „Medicus“ – zuständig für medizinische Prozeduren und die Therapie (inkl. der Agenzien) – und „Archaeus“ beschrieb. Die Idee eines Archaeus entsprach dabei weitestgehend jenem „inneren Arzt“, einer ordnenden Kraft, die nach Paracelsus auch eine Verbindung zum fein- oder nichtstofflichen Bereich besaß. Gemeint war hier wohl das, was wir heute mit „Bewusstsein“ oder „Geist“ (engl. mind) bezeichnen – Konzepte, die es in dieser Form im heutigen Europa, kurz vor Descartes, nicht gab. Auch in der Ordnungstherapie eines Sebastian Kneipp im 19. Jahrhundert tauchen deutliche Analogien auf.
All diesen oben beschriebenen Entwicklungen war gemein, dass Heilung mit der Annahme regulativer Prozesse einherging, d.h. sie war dynamisch und strebte im Normalfall von sich aus zum Gleichgewicht, zur Gesundheit also, die wiederum der Beeinflussung durch den Einzelnen zugänglich war. Wenn diese „natürliche Tendenz“ zu Gesunderhalt oder Wiederherstellung (Restitutio) nicht ausreichte oder die Selbstregulation überfordert war, konnte Einflussnahme von außen geboten sein. Noch bei Rudolf Virchow im 19. Jahrhundert (Virchow 1875) findet sich jene Idee der Selbstregulation (und Krankheit als Manifestation einer Überforderung derselben), bevor sie im Zuge der aufkommenden Naturwissenschaft aus dem Blickfeld der Medizin geriet. Es kam zu einem Auseinanderdriften der zugrunde liegenden Konzepte, mit der Konsequenz, dass „Glaube“ (im beschriebenen Sinn) und Selbstregulation zunehmend an den Rand gedrängt wurden, zusammen oder getrennt voneinander. Dort, in der Naturheilkunde und Komplementärmedizin usw., überdauerten sie und führten, bis vor kurzem, ein bescheidenes, aber doch reales Dasein. In der sogenannten Schulmedizin tauchten sie als Placebo-Effekte (auch als Kontext- oder unspezifischer Effekte bezeichnet und seit dem Jahr 2000 zunehmend wissenschaftlich erforscht) immer wieder auf. Hier allerdings kamen sie aus der Hand des Arztes oder Wissenschaftlers, deren Bedeutung in einer Art Gegenbewegung kontinuierlich gewachsen war.