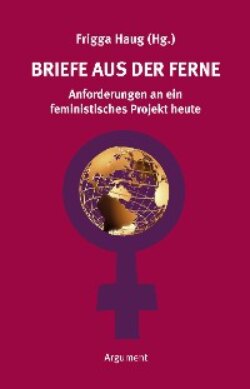Читать книгу Briefe aus der Ferne - Группа авторов - Страница 15
In Prozesse der Prekarisierung13 eingreifen
ОглавлениеDas Linkssein ist immer das, was neu zu durchdenken ist. Demnach ist das neue Durchdenken Teil dessen, was es heißt, links und in der Linken zu sein. Ich denke dazu: Es ist zwingend erforderlich, die Prozesse der Minderheitenbildung im Licht der gegenwärtigen Kriege in Afghanistan und im Irak und der israelischen Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung neu zu durchdenken und zu verstehen, wie diese Kriege die politische Diskussion über Einwanderung, den Status des Rechts, die Moral der Folter sowie über Sexualpolitiken und auch den Feminismus in Europa und den USA strukturieren. Dabei gehe ich davon aus, dass Denkmuster weithin akzeptiert worden sind, die Minderheiten gegeneinander ausspielen und die in der Linken das Gefühl einer Ausweglosigkeit erzeugen. Ich behaupte, dass die Linke dadurch gestärkt wird, dass sie ihre kritische Aufmerksamkeit auf den Staat, insbesondere auf staatlichen Zwang richtet und auf die Macht staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen, über Fragen der Staatsbürgerschaft zu entscheiden und damit darüber, welche Art Leben als berechtigt zu betrachten ist und welche nicht.
Dazu gehört das Begreifen, weshalb und in welcher Weise bestimmte Teile der Bevölkerung in Bedingungen ernster Prekarität geworfen werden, und die Suche nach Analysen und Bündnissen, die uns über die gewohnten Konzepte von Multikulturalismus und Identitätspolitik hinausbringen. Ich möchte des Weiteren behaupten, dass Bündnisse, um lebendig, einschließend und zielgerichtet zu bleiben, innere Antagonismen, den offenen Streit über Glauben und Praxis bejahen können müssen. Das wird meines Erachtens möglich, wenn die Linke sich auf staatliche Gewalt, staatlichen Zwang und die verschiedenen Formen radikal ungleicher Verteilung der Prekarität auf unterschiedliche Teile der Bevölkerung konzentriert. Minderheitenbildung ist ein Prozess, der auf sehr spezielle Weisen funktioniert, aber er bringt Bedingungen für Bündnisse hervor, insbesondere wenn überkommene Bezugssysteme im Dienst einer Kritik zunichtegemacht werden, die sich auf die Verknüpfung der gegenwärtigen Kriege mit den selbstverständlichen politischen Denkformen konzentriert.
Über Bündnisse nachzudenken ist nicht einfach, und Bündnisse selbst sind nichts Einfaches. Manche glauben, wir müssten lediglich den Diskurs über Rechte stärken und Verbands- und Gruppenrechte durchsetzen. Einige haben für Verbandsrechte lokaler religiöser Gemeinschaften plädiert, mit der Begründung, dass der Entzug solcher Rechte zur Entmündigung solcher Gemeinschaften führe oder sogar zu ihrer Entwurzelung (Woodhead 2008). Natürlich müsste ein solches Projekt in der Lage sein, Gemeinschaften örtlich festzulegen, und sie als stabile und selbständige Einheiten behandeln, was zu komplizierten Entscheidungen darüber führen würde, wie sich Gruppenzugehörigkeit bestimmt. Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist zwar, dass er einen gewissen Individualismus durch die Vorstellung von Gruppenrechten ergänzt, die Beschränkung liegt aber darin, dass die »Gruppe« oder die »Gemeinschaft« als einheitliches Subjekt wirkt, wo doch gerade jetzt neue gesellschaftliche Formationen erfordern, dass wir über solche mutmaßlichen Einheiten hinaus oder gegen sie denken.
Die Strategie, ein Bündniskonzept von Staatsbürgerschaft wie auch von Verbandsrechten zu entwickeln, mag der Ausweitung bestehender demokratischer Normen hin zu mehr Inklusion und zur Überwindung von Pattsituationen zwischen individuellen und religiösen Ansprüchen und Rechten dienen. Zweifellos bergen solche Strategien Stärken und Versprechen. Ich möchte nur auf das Spannungsverhältnis aufmerksam machen zwischen einer Ausweitung bestehender normativer Begriffe von »Bürger«, »Anerkennung« und »Rechten« einerseits, um die gegenwärtige Ausweglosigkeit zu fassen und zu überwinden, und andererseits dem Ruf nach einem alternativen Vokabular, der in der Überzeugung gründet, dass die normativen Diskurse aus Liberalismus und Multikulturalismus gleichermaßen untauglich sind, um neue Subjektbildungen und neue Formen sozialer und politischer Antagonismen zu erfassen.
Obwohl ich die Bedeutung sozialer und kultureller Konflikte in der gegenwärtigen Politik nicht unterschätzen möchte, will ich »Ausweglosigkeit« nicht als unumgängliche Struktureigenschaft von Multikulturalismus ansehen, wie verbreitet diese Deutung einer »Pattsituation« zum Beispiel zwischen religiösen und sexuellen Minderheiten auch ist. Es gibt zahlreiche religiöse Schwulen- und Lesbengruppen, von denen einige für Teile der Homoehen-Kampagnen in den USA verantwortlich waren. Es gibt Koalitionen zwischen »Queeren« und »illegalen Einwanderern« oder sans papiers in den USA und Europa, die zusammenarbeiten, ohne im Vorfeld ihrer Bündnisbemühungen in Konflikt über sexuelle Identität und religiösen Glauben zu geraten. Es gibt zahlreiche Netzwerke von muslimischen Lesben und Schwulen (etwa im Club SO36 in Berlin-Kreuzberg), die zeigen, dass der Gegensatz kein notwendiger ist.14 Wenn wir bedenken, welch negativen Einfluss der Status der HIV-Infizierung auf die Möglichkeit von Individuen hat, zu migrieren oder angemessene Gesundheitsversorgung zu bekommen, wird deutlich, wie unter dem Dach der Einwanderungspolitik Gemeinschaften, die für Rechte kämpfen und durch Zusammenschluss von Identitäten gekennzeichnet sind, gebildet werden können. Wenn die Begriffe Multikulturalismus und Anerkennungspolitik entweder die Reduktion des Subjekts auf eine einzige definierende Eigenschaft oder die Konstruktion eines mehrschichtig bestimmten Subjekts verlangen, dann sind wir noch nicht in der Lage, uns der Herausforderung der kulturellen Metaphysik zu stellen, die sich durch die Bildung neuer globaler Netzwerke und Institutionen ergibt und die verschiedene dynamische Bestimmungen gleichzeitig durchkreuzt und anregt.
Wenn solche Netzwerke Grundlage politischer Bündnisse sind, sind sie weniger durch »Identität« oder allgemein akzeptierte Anerkennungsformen zusammengehalten als durch Formen politischer Opposition gegen staatliche oder andere Regulierungspolitik, die dazu führt, dass Menschen ausgeschlossen oder ausgestoßen werden, teilweise oder vollständig ihre Staatsbürgerschaft verlieren, untergeordnet oder erniedrigt werden und dergleichen. In diesem Sinne beruhen Bündnisse nicht notwendigerweise auf Subjektpositionen oder darauf, Unterschiede zwischen Subjektpositionen zu versöhnen; tatsächlich können sie auf sich zeitweilig überschneidende Ziele gegründet werden und können – müssen vielleicht – aktive Antagonismen darüber enthalten, was sie sein wollen und wie sie das am besten erreichen. Sie sind bewegliche Felder von Differenzen in dem Sinn, dass »durch andere bewirkt zu sein« und »auf andere einzuwirken« Teil der sozialen Ontologie des Subjekts ist, so dass »das Subjekt« weniger eine klar umrissene Substanz als eine aktive und veränderliche Menge von Wechselbeziehungen ist.
Ich bin keineswegs überzeugt, dass es einen »vereinigenden« Begriff gibt, der alle Formen der Enteignung abdeckt, die Minderheitenpolitiken verbinden, noch dass man einen solchen für die strategischen Zwecke politischer Bündnisbildung braucht. Aber es ist notwendig, dass alle, die an einem solchen Bündnis mitarbeiten, sich aktiv daran beteiligen, die Kategorie »Minderheit« zu durchdenken, wo sie die Grenzen durchkreuzt, die Staatsbürger vom Nichtstaatsbürger trennen. Durch den Fokus auf Staat und Regulierungsmächte und darauf, wie sie die Debatte inszenieren und die Begriffe für politische Ausweglosigkeiten fertigen, überschreiten wir den Denkrahmen, der binäre Gegensätze unterstellt oder aus einer komplexen Formation einen »Konflikt« derart gewinnt, dass die Inszenierungs- und Zwangsdimensionen normativer Rahmen verdeckt werden. Indem die Machtfrage ins Zentrum der Debatte gerückt wird, müssen sich die Begriffe ändern und dabei politisch reaktionsfähig werden.
Wie inszenieren also Machtformen, einschließlich der Staatsmacht, das Feld binärer Gegensätze, das zwei getrennte, durch einzelne oder mehrere Eigenschaften bestimmte und sich gegenseitig ausschließende Subjekte erfordern? Solche Subjekte als gegeben zu unterstellen heißt, die kritische Aufmerksamkeit von den Operationen der Macht selbst, einschließlich der »Inszenierungseffekte« der Macht in der und auf die Subjektbildung, wegzulenken. Folglich warne ich vor den Erzählungen einer Fortschrittsgeschichte, in denen der binäre Konflikt entweder durch umfassendere und einschließende liberale fortschrittliche Bezugsrahmen überwunden wird oder die Fortschrittsillusion selbst zum definierenden Element des Kampfs zur Verteidigung des Liberalismus wird. Im ersten Fall entwickeln wir einschließendere Bezugsrahmen, um den Antagonismus aufzulösen. Im zweiten Fall behaupten wir, dass die säkulare und fortschrittliche Alternative das sine qua non liberaler Demokratie ist, und erklären allen Bemühungen, die Notwendigkeit, Zulänglichkeit und den Wert dieses Rahmens zu überdenken und in Frage zu stellen, den Krieg. Die erste Erzählung charakterisiert dialektische, pragmatistische und fortschrittliche Auffassungen von Geschichte; die zweite macht das »Fortschrittliche« zum einen Pol eines Konflikts und erklärt jedes nichtsäkulare und antifortschrittliche Vokabular zur Bedrohung für den Liberalismus, einschließlich aller Bemühungen, ein anderes Vokabular zu entdecken oder zu entwickeln, mit dem über neu entstehende Subjekte und wirkungsvolle Sprachen, Medien und Ausdrucksweisen für politische Rechte nachgedacht werden kann.
Ich stelle mir gewiss kein »nahtloses« Bündnis von religiösen und sexuellen Minderheiten vor. Es gibt solche Bündnisse, also ist es sinnvoll zu fragen, wie sie gebildet sind. Und es ist auch sinnvoll anzunehmen, dass der Antagonismus durchaus eine bleibende Eigenschaft solcher Bündnisse sein kann. Vielleicht schließen Bündnisse gewisse Brüche, Misserfolge, fortbestehende Antagonismen ein. Und wenn ich »einschließen« sage, meine ich damit nicht, dass das Bündnis solche Antagonismen kittet oder auflöst. Im Gegenteil möchte ich mit Laclau und Mouffe (1991) daran festhalten, dass der Antagonismus das Bündnis offen hält und die Idee einer Versöhnung als Ziel aufhebt. Was ein Bündnis zusammenhalten kann, ist eine andere Frage, als was es beweglich hält. Und was es beweglich hält, ist meines Erachtens der dauernde Fokus auf die Machtformationen, die über die scharfe Identitätsdefinition der am Bündnis Beteiligten hinausgehen. In diesem Fall müsste sich das Bündnis auf Zwangsmittel des Staates (von Einwanderungstests bis zur direkten Folter) und die Anrufungen (und Simplifizierungen) von Subjekt, Natur, Kultur und Religion konzentrieren, die den ontologischen Horizont hervorbringen, in dem staatlicher Zwang notwendig und gerechtfertigt erscheint.
Die Staatsmacht agiert innerhalb eines ontologischen Horizonts, der mit Macht gesättigt ist, die der Staatsmacht vorausgeht und sie übersteigt. Folglich können wir Macht nicht richtig verstehen, wenn wir immer den Staat im Zentrum ihres Wirkens sehen. Der Staat greift auf nichtstaatliche Machtoperationen zurück und kann selbst nicht ohne diese Machtreserve funktionieren, die nicht durch ihn organisiert wird. Hinzu kommt – und das ist nicht sonderlich neu –, dass der Staat gewisse Machtoperationen gleichzeitig produziert und voraussetzt, die hauptsächlich durch Schaffung einer Reihe »ontologischer Gegebenheiten« wirken. Zu diesen Gegebenheiten gehören ebendie Vorstellungen von Subjekt, Kultur, Identität und Religion, die innerhalb besonderer normativer Bezugsrahmen unbestritten bleiben und auch nicht bestritten werden können. Wenn wir also in diesem Zusammenhang von »Bezugsrahmen« sprechen, reden wir nicht bloß über theoretische Perspektiven, die wir in die Politikanalyse bringen, sondern über Sinnverständnisweisen, die für das Funktionieren des Staats förderlich sind und damit selbst Machtausübung darstellen, auch wenn sie den spezifischen Bereich der Staatsmacht überschreiten.
Vielleicht wird die »Ausweglosigkeit« am besten wahrnehmbar, wenn sie nicht zwischen dem Subjekt einer sexuellen und dem einer religiösen Minderheit auftritt, sondern zwischen einem normativen Bezugsrahmen, der solche in gegenseitigem Widerstreit befindliche Subjekte erfordert und produziert, und einer kritischen Perspektive, die in Frage stellt, dass und wie solche Subjekte außerhalb dieses mutmaßlichen Antagonismus – oder in anderem Verhältnis dazu – existieren. Das hieße dann zu bedenken, inwiefern dieser Bezugsrahmen eine Weigerung voraussetzt und hervorruft, die Komplexität der historischen Entstehung religiöser/sexueller Bevölkerungen und Subjektbildungen zu verstehen, die nicht auf eine der Identitätsformen reduzierbar sind. Einerseits kann man sagen, dass solche Reduktionen, wie verfälschend auch immer, notwendig sind, weil sie normative Urteile in einem festgelegten und als Wissen verfügbaren Bezugsrahmen ermöglichen. Das Verlangen nach epistemologischer Gewissheit und sicherem Urteil bringt so eine Reihe ontologischer Verbindlichkeiten hervor, die wahr oder falsch sein mögen, die aber für notwendig erachtet werden, um an bestehenden epistemologischen und ethischen Normen festzuhalten. Andererseits richten die Praxis der Kritik und die Praxis der Bereitstellung adäquateren historischen Wissens ihr Augenmerk auf die von den normativen Bezugsrahmen erzeugte normative Gewalt und bieten damit eine alternative Bedeutung der Normativität selbst – eine, die weniger auf vorgefertigten Urteilen als auf einer Art vergleichendem auswertendem Schließen beruht, zu dem man durch die Praxis des kritischen Verstehens gelangt.
Trotzdem muss jedes kritische Verstehen sich auf das Prekärsein des Lebens einstellen, daher möchte ich zur Vorstellung der »Prekarität« als einem nachdrücklich nicht-identitären Begriff zurückkehren, der linke Politik stützt. Wenn wir das Prekärsein des Lebens als Ausgangspunkt nehmen, gibt es kein Leben ohne Bedarf an Obdach und Nahrung, kein Leben ohne Abhängigkeit von größeren Netzwerken von Gemeinschaft und Arbeit, kein Leben, das Verletzlichkeit und Sterblichkeit überwindet. Wir könnten dann einige der kulturellen Folgen militärischer Macht heute als Versuch analysieren, das Prekärsein für andere zu maximieren, während das Prekärsein der betreffenden Macht minimiert wird. Diese ungleiche Verteilung der Prekarität ist zugleich eine materielle Frage und eine der Wahrnehmung, denn jenen, deren Leben nicht als potenziell betrauerbar und dementsprechend wertvoll »betrachtet« wird, wird die Last des Verhungerns, der Unterbeschäftigung, der gesetzlichen Entrechtung und des ungleich größeren Risikos von Gewalt und Tod aufgebürdet.
Diese allgemeine Bedingung von Prekärsein und Abhängigkeit wird in bestimmten politischen Formationen ausgebeutet und in Abrede gestellt. Kein noch so großer Wille oder Reichtum kann die Möglichkeit ausschließen, dass ein lebender Körper krank wird oder einen Unfall hat, auch wenn beide im Dienste einer solchen Illusion mobilisiert werden können. Diese Gefahren gehören zur Vorstellung des als endlich und prekär angesehenen körperlichen Lebens selbst; sie implizieren, dass der Körper immer dem Gemeinwesen und der Umwelt überantwortet ist, die seine individuelle Autonomie begrenzen. Aus der von allen geteilten Bedingung des Prekärseins folgt, dass der Körper konstitutiv gesellschaftlich und in wechselseitiger Abhängigkeit ist. Und doch versuchen die gegenwärtigen Kriege, genau diese unumkehrbare wechselseitige Abhängigkeit zu leugnen. Die Logik und Praxis ungezügelter politischer Herrschaft – wie wir sie unter dem Bush-Regime erlebten – strebt nach der Herstellung eines nationalen Subjekts, das sich selbst als undurchdringlich, unabhängig betrachtet, seine eigenen Verfassungsrechte aussetzt und die Souveränität anderer Nationen missachtet. Erinnern wir uns, dass die von den USA errichteten und unterhaltenen Kriegsgefängnisse Orte sind, wo kein legitimes Recht herrscht, wo Staatsbürgerrechte und internationaler Schutz ausgesetzt sind. Die Begründungen für diese Kriege waren ebenso außerrechtlich und haben endlose Verwirrung darüber gestiftet, ob diese Kriege dem Terror, der Tyrannei oder dem Islam selbst gelten. Mit dem Ergebnis, dass die Produktion des »islamischen Extremisten« als Repräsentant des Islam nicht nur als Teil jener Ideologie fungiert, die die Fortführung des Krieges begründet, sondern auch als Gespenst in der Einwanderungspolitik wiederkehrt, die, besonders in Frankreich und den Niederlanden, strenge Richtlinien der Loyalität und »kulturellen Integration« geltend macht. Die Einwanderungspolitik bildet die heimische Entsprechung dieser aktuellen Kriege, so dass Europa verstanden wird als mit der Verteidigung seiner Grenzen gegen mögliche Invasoren befasst, gegen Verunreinigung nicht nur in der Zukunft, sondern gegen die kulturelle und »rassische« (racial) Komplexität seiner gegenwärtigen Bevölkerung.
Und doch macht die offizielle Begründung, die für solche Kriege gegeben wird, oftmals unzulässigen Gebrauch von fortschrittlicher Politik. Im Krieg gegen Afghanistan gab es unzulässige Beschwörungen von »Feminismus«, als die USA für sich in Anspruch nahmen, afghanische Frauen aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Dass jüngst Ayaan Hirsi Ali gefeiert wird, stellt eine ähnliche Bemühung dar, Feminismus als antiislamisch zu definieren und den »Westen« als sicheren Hafen für Frauen zu feiern. Ähnlich behaupteten die niederländischen Staatsbürgerschaftstests, die Verteidigung von Homosexuellenrechten sei Zeichen ihrer Modernität. In diesen Fällen werden sowohl Feminismus als auch fortschrittliche Sexualpolitiken dazu instrumentalisiert, religiöse und ethnische Minderheiten zu dämonisieren und herabzusetzen. Im Ergebnis können wir erkennen, wie der Staat in der Kriegsrhetorik und in der Einwanderungspolitik versucht, sexuelle Minderheiten und Frauen von neuen und jüngeren religiösen Minderheiten zu trennen. Mit anderen Worten: Der Staat versucht die Möglichkeit eines Bündnisses, das aus sich überschneidenden Prozessen der Minderheitenbildung entstehen kann, zu untergraben. Diese Fassung der gegenwärtigen Situation übersieht, dass diese verschiedenen Identitäten einander bereits kreuzen und wichtige Bindungen unterhalten: Es gibt muslimische feministische Bewegungen, arabische Schwulenorganisationen und -bars und verschiedene Formen der Bündnispolitik, in denen eine Reihe von Leuten aus all diesen Gruppen zusammenarbeiten, um sich gegen Diskriminierung, gesetzliche Entrechtung, Polizeischikane und staatlichen Zwang zu wehren.
Ich möchte mit zwei Punkten schließen. Erstens: Ein neues Verständnis der Linken bleibt nicht bei einer neuen und komplexen Reflexion über Prozesse der Minderheitenbildung stehen, die die Entstehung und Auslöschung verschiedener Gruppen beeinflussen. Zweitens: Wir müssen die wichtige Frage der Prekarität einbeziehen. Diejenigen, deren Leben Hunger, Obdachlosigkeit, Armut, gesetzlicher und politischer Entrechtung und mangelnder Gesundheitsversorgung ausgesetzt ist, bilden prekäre Bevölkerungen, solche, deren Leben extremen Bedingungen von Prekarität unterworfen ist. Wir könnten zwar sagen, dass jedes Leben prekäres Leben ist, dennoch bleibt wahr, dass manches Leben in die Prekarität gestoßen, nicht als schützenswert, nicht als wertvoll angesehen wird, ja nicht einmal als betrauernswert, wenn es verloren wird. Das nicht betrauerbare Leben ist das Leben, das nie als Leben angesehen wurde, und somit auch das unlebbare Leben. Wir müssen die konventionellen Modelle des Multikulturalismus überschreiten, um zu verstehen, wie Prekarität ungleich verteilt ist.
Der Widerstand gegen die ungleiche Verteilung der Prekarität ist ein wichtiger Punkt für jedes zukünftige Bündnis. Entsprechend müssen sich Bündnisse und Allianzen weiter dem Kampf sowohl gegen Rassismus als auch gegen Homophobie verpflichten, sowohl gegen einwanderungsfeindliche Politik als auch gegen mannigfaltige Formen von Frauenfeindlichkeit. Eine starke Bewegung auf der Linken muss Bündnisse mit religiösen und sexuellen Minderheiten gleichermaßen suchen und aufrechterhalten und sich auf die Kritik von staatlichem Zwang und staatlicher Gewalt konzentrieren. Diese letztgenannte Kritik würde auch zu einem Argument gegen die gegenwärtigen Diskurszwänge im politischen Denken, die Minderheitenpositionen und -interessen polarisieren.
Ich will nicht behaupten, dass Bündnisse immer glücklich sind oder immer funktionieren. Ich denke vielmehr, dass es Antagonismen gibt, die zum Bündnis dazugehören, und dass der Antagonismus Bündnisse offen, selbstkritisch und dynamisch hält. Die Frage ist, wie man im Rahmen von Bündnissen Antagonismen aufrechterhalten kann, und das bedeutet, den temporären und unbeständigen Charakter dieser sozialen Form zu akzeptieren. Wie denken wir über einen Kampf, in dem Subjekte durch die politischen Ziele des Kampfes und durch ihre Zusammenarbeit verändert werden? Wird das Subjekt auf diese Weise zum Gemeinwesen? Und wie denken wir über diese Transformation selbst als Ziel der Bewegung selbst? Ein Grund für die Unmöglichkeit, das Subjekt als Grundlage für Politik zu nehmen, besteht darin, dass es ständig im Prozess der Formung ist. Es wird nicht nur von und durch Macht geformt, sondern auch im Verhältnis zu anderen Subjektformierungen. Das Subjekt wird etwas anderes kraft seiner politischen Aktivität, was bedeutet, dass das Subjekt kein fester Ausgangspunkt ist. Und es strebt auch nicht einfach oder immer danach, zu sich zurückzukehren. Was, wenn es keine Rückkehr zum früheren Selbst gibt? Was, wenn wir alle als Folge neuer politischer Herausforderungen, denen wir begegnen, Veränderungen durchmachen müssen? Das Subjekt, das in ein Bündnis eintritt, ist dann nicht dasselbe wie das Subjekt, das durch das Bündnis transformiert wurde. Und die politische Praxis transformiert das Subjekt der Politik. Das bedeutet auch, dass dort nicht die erhoffte Ordnung erneuert wird, sondern lediglich die Aufgabe, in neuer Unordnung einen Sinn zu finden, der uns mehr oder weniger zusammenhält.