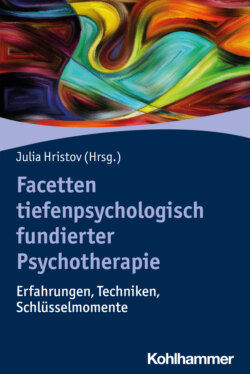Читать книгу Facetten tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Unsicherheit überwinden
ОглавлениеViele Therapieinteressierte und angehende Psychotherapeut*innen stellen sich nun wahrscheinlich die Frage, wie sie die oben kurz angeführten Konzepte und Grundgedanken der tiefenpsychologisch- psychodynamischen Sichtweise im therapeutischen Setting, d. h. im direkten Patient*innenkontakt, ganz konkret umsetzen können. Sie fühlen sich oftmals unsicher, in ihrer Position verantwortlich für die Beziehungsgestaltung und erleben den eingangs erwähnten Erwartungsdruck durch die Patient*innen.
Zusammenfassend kann ich folgende Faktoren benennen, die mir geholfen haben, meine anfängliche Unsicherheit zu überwinden und meinen Patient*innen weiterhin mit Neugier, Interesse, Wertschätzung und Mitgefühl, aber auch mit mehr Gelassenheit und Vertrauen in ihre Fähigkeiten und den therapeutischen Prozess zu begegnen:
In Beziehung gehen mit den Patient*innen: Das ist wohl der wichtigste Faktor, nicht nur, weil man aus eigenen Erfahrungen bekanntlich am meisten lernt, auch weil das tiefenpsychologische Arbeiten das Einlassen auf eine Beziehung voraussetzt. Dabei kann nicht im ersten Termin die gesamte, meist unbewusste Dynamik sofort verstanden werden, auch müssen nicht Symptome nach einem Termin verschwinden. Es ist erstaunlich zu erleben, wie sich für die Patient*innen typische Beziehungsmuster auch in den Therapiestunden zeigen und in der direkten Beziehung aufgegriffen werden können und wie hartnäckig Kinder wieder und wieder dieselben Spielsequenzen wiederholen, bis sie schließlich irgendwann durch die Therapeut*innen verstanden werden.
Supervision/Intervision und der Austausch mit Kolleg*innen: Es ist lehrreich, aufmunternd und ermutigend, sich mit angehenden und erfahrenen Kolleg*innen darüber auszutauschen, wie es ihnen mit ihren ersten Patient*innen erging, was ihnen Orientierung gegeben hat, welche Erfahrungen für sie wertvoll waren. Supervision ermöglicht es, das eigene therapeutische Vorgehen, die Dynamik zwischen Therapeut*in und Patient*in zu reflektieren, Rückmeldungen und neuen Input (ganz konkret, in Form einer Sicht von außen oder durch das Verstehen bestimmter Szenen) für die weitere Behandlung zu bekommen.
Selbsterfahrung: Sowohl einzeln als auch in der Gruppe war dies eine wertvolle Erfahrung für mich. Selbsterfahrung dient dazu, sich seiner Lebensgeschichte, eigener Themen und Beziehungsmuster bewusst zu werden – damit verbunden auch der eigenen Verletzlichkeit, erlebter oder befürchteter Kränkungen, Ängste und Themen, die man vielleicht aus Scham oder Schuldgefühlen meidet. Sich bewusst über seine eigene Geschichte, sein Erleben und seine Prägung zu sein, hilft wiederum, diese nicht in der Therapiesitzung auf die Patient*innen zu übertragen oder ihnen gar aufzudrängen, sondern als Eigenes wahrzunehmen.
Fachliteratur: Viel zu lesen (und damit auch nie aufzuhören) ist unabdingbar, um sich einen Überblick über therapeutische Konzepte, Wirkmechanismen, aktuelle Forschungsergebnisse etc. zu verschaffen und ein theoretisches Fundament für das eigene Arbeiten aufzubauen. Sowohl Wöller und Kruse (2018) als auch Rudolf (2019) geben in ihren Fachbüchern einen leicht zugänglichen und verständlichen Überblick über die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Gleichzeitig ermöglicht das Lesen von Fachliteratur und Eintauchen in Fallbeispiele aus Sicht verschiedener Therapeut*innen, ihre Ansätze und ihr Vorgehen und damit ein therapeutisches Vorbild kennen zu lernen.
Der erste Punkt scheint mir dabei gleichzeitig am wichtigsten und am unkontrollierbarsten, für angehende Therapeut*innen spannend und zugleich verunsichernd – mitunter aufgrund der empfundenen Verantwortung gegenüber den Patient*innen und dem Wunsch, diese möglichst schnell zu entlasten, ihnen zu helfen. Auch um einen fantasierten Beziehungsabbruch zu vermeiden, die Befürchtung, die Hilfesuchenden könnten sich anderswo Unterstützung holen, wenn nicht möglichst schnell eine Besserung eintritt. In den nachfolgenden Kapiteln möchten wir ermutigen, die anfängliche (und immer wieder auftauchende) Unsicherheit anzunehmen und sie reflektiert in die therapeutische Arbeit einfließen zu lassen und gleichzeitig aufzeigen, welche lohnenswerten Erfahrungen in der Therapeut*in-Patient*in-Beziehung entstehen können.