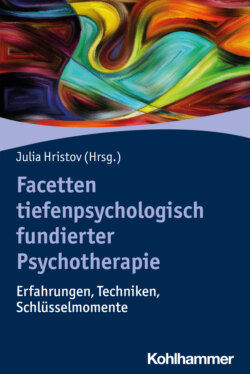Читать книгу Facetten tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2 Die Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik
ОглавлениеIn der Begegnung von Patient*in und Psychotherapeut*in übertragen beide vergangene Erfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen unbewusst aufeinander. Es kann ein wechselseitiges Erleben entstehen, welches im Zusammenhang mit früheren Beziehungserfahrungen steht. Bereits in den ersten Begegnungen können Übertragung und Gegenübertragung sehr deutlich werden.
Die Übertragung des*der Patient*in ist einerseits eine Wiederholung der Vergangenheit: Jede therapeutische Begegnung wird durch unbewusste Objektbeziehungen geformt. Pathogene Beziehungserfahrungen können so in ihrer Wirkung auf die Gegenwart wahrgenommen werden. Gleichermaßen ist die Übertragung ein Resultat der gegenwärtigen therapeutischen Situation und eine implizite Reaktion auf die reale Person des*der Therapeut*in.
Behandler*innen versuchen das eine vom anderen zu trennen, um die Wiederherstellung von infantilen Beziehungen bei den Patient*innen zu erkennen. Hier ist es natürlich für die Arbeit als Psychotherapeut*in wichtig, die eigenen Übertragungsbereitschaften zu kennen. In der Ausbildung von Psychotherapeut*innen wird in der Supervision und Selbsterfahrung ein Bewusstsein für Übertragungsprozesse geschaffen. In der Alltagspraxis können mithilfe von Supervision und kollegialer Intervision die komplizierten Beziehungsdynamiken reflektiert werden.
Die Gegenübertragung der Psychotherapeut*innen umfasst aus heutiger Sicht alle Gefühle, innere Wahrnehmungen, Impulse und Handlungstendenzen, die Therapeut*innen ihren Patient*innen gegenüber empfinden. Im klassischen Sinne ist die Gegenübertragung eine Reaktion der Therapeut*innen auf die Übertragung der Hilfesuchenden. Eigentlich ist es unmöglich, genau zu unterscheiden, welche Reaktionen der Therapeut*innen sich einzig auf die Übertragung der Patient*innen beziehen, da diese Reaktionen immer auch durch unbewusste Konflikte der Psychotherapeut*innen verzerrt sind. Mithilfe gegenseitiger Verwicklung in der direkten therapeutischen Begegnung und deren Reflexion ist es möglich, das Gegenübertragungserleben in seine interpersonellen Anteile aufzuschlüsseln und Hypothesen zur aktivierten Objektbeziehung zu bilden. Die Gegenübertragung ist ein steter Begleiter tiefenpsychologisch fundiert arbeitender Psychotherapeut*innen, und es lohnt sich, den eigenen Resonanzkörper gut zu kennen und zu schärfen.
Eine Gefahr der gegenseitigen Verwicklung in der Begegnung ist das unbewusste handelnde Ausagieren der Gegenübertragung (Wöller & Kruse, 2018). Besonders Menschen mit strukturellen Störungen lösen starke emotionale Gegenübertragungsreaktionen aus, es entsteht ein regelrechter Gegenübertragungssog. Dann kann es schnell zur Bestätigung der pathogenen Überzeugungen der Patient*innen kommen. Das sollte vor allem in den ersten Begegnungen vermieden werden. Erst, wenn mir als denkende Therapeutin (Zwiebel, 2013) klar geworden ist, welcher Teil meiner Gegenübertragung für den*die Patient*in im aktuellen Therapieprozess hilfreich ist, gebe ich ihn in den Kontakt.
Im Folgenden ein Beispiel für eine Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik und wie sie therapeutisch nutzbar wird:
Eine Patientin brachte mich nach langen, anstrengenden Dialogen durch einen Witz zum Lachen. Automatisch ließ ich mich von ihr anstecken und war etwas erleichtert. Das Lachen fühlte sich wenig später aufgezwungen an, ich hatte den Impuls mich wegzudrehen; dann ging ich vor meinem inneren Auge alles durch, was ich heute Nachmittag noch erledigen muss.
Dieses ungewöhnliche Erleben bewahrte ich in mir, ließ es sich innerlich entfalten; dann fragte ich mich, was es für unsere Beziehung und den Therapieprozess bedeuten könnte.
Um dann diese Beziehungssituation wie einen Tropfen Blut unter dem Mikroskop zu betrachten, fragte ich die Patientin, wie sie gerade den Kontakt mit mir erlebt habe. Darauf antwortete sie, wenn sie einen Witz mache, sei es gut, wenn ich lache, aber sie selbst lache nicht so richtig mit. Die Bedeutung meiner Gegenübertragung wurde mir bewusster und ich brachte sie in die gemeinsame Untersuchung ein: »Das Lachen war erfrischend, aber ich frage mich, warum Sie hier, in Ihrer Therapiestunde, für mich sorgen wollen.«
So war ihr pathologisches Beziehungsmuster im direkten Kontakt erlebbar und emotional bearbeitbar. Wir kamen in einen Austausch darüber, wann sie in unserem Kontakt für mich sorgen und mich nicht belasten wolle, nämlich immer, wenn sie glaube, keine ausreichend gute Patientin zu sein. Ich solle Freude an der Therapie behalten, damit ich sie nicht fallen lasse. In der Suche nach der biografischen Entsprechung erzählte sie, dass sie schon als Kind für ihre chronisch kranke Mutter sorgen musste, damit für sie selbst gesorgt war.
Darüber hinaus war es in der Behandlung entscheidend, nicht nur ihren passiven, sondern vor allem ihren heutigen aktiven Anteil am dysfunktionalen Beziehungsgeschehen durchzuarbeiten. Mit anderen Worten: Was macht sie in der therapeutischen Beziehung, sodass ihre Angst, das Gegenüber wird sich abwenden, in meiner Gegenübertragung wahr werden konnte? Genauso wie das Fürden-anderen-Sorgen damals ein konstruktiver Umgang mit schwierigen Bedingungen war, manipuliert und kontrolliert sie heute damit das Gegenüber, wie auch mich. Die emotionale Einsicht, dass sie mit diesem unbewussten Relikt ihren bewussten Wunsch nach Kontakt boykottiert, konnte so wachsen.
Auf der Grundlage einer wertschätzenden, stabilen Arbeitsbeziehung kann es enorm hilfreich sein, diesen, von Patient*innen aktiv in den Kontakt gebrachten unbewussten Teil, der in der Gegenübertragung erlebbar ist, bewusst zu machen.
Als eine weitere zentrale Säule zur Entfaltung der Psychodynamik und als wertvolles Diagnoseinstrument in den ersten Begegnungen hat sich die Probetherapie bewährt.