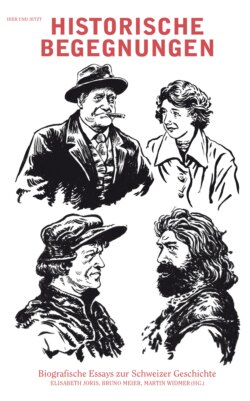Читать книгу Historische Begegnungen - Группа авторов - Страница 10
Alles ist offen: der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Bodensee und Genfersee
ОглавлениеAm 28. September 1343, ein knappes Jahr nach dem eingangs geschilderten Eheversprechen in Brugg, gipfelt die Versöhnung zwischen der Stadt Zürich, den 1336 verbannten Räten und dem Haus Habsburg beziehungsweise Habsburg-Laufenburg in einem weit gehenden Bündnis zwischen den mittlerweile mündigen Söhnen Johanns von Habsburg-Laufenburg – Johann II. und Gottfried – und der Stadt Zürich. Die Stadt Rapperswil wird in das Bündnis miteinbezogen. Rudolf Brun kann seinen Einfluss am oberen Zürichsee stärken und die Grafen von Rapperswil, die bei verschiedenen Zürcher Bürgern Schulden haben, stärker an die Stadt Zürich binden. Herzog Albrecht – seit Ende 1337 wieder ständig in Wien – scheint in dieses Bündnisprojekt nicht involviert zu sein. In der Folge schliessen weitere Verbannte Frieden mit der Stadt. Die Wunden sind aber nicht verheilt, wie die Konspiration zur Zürcher Mordnacht nur sechs Jahre später zeigen wird.
In welcher politischen Grosswetterlage stehen aber die Stadt Zürich und Habsburg-Österreich zueinander in diesen Jahren? Dazu noch einmal eine kurze Rückblende vor den Umsturz von 1336. Nach dem Tod des Gegenkönigs Friedrich von Habsburg im Januar 1330 begannen seine Brüder Otto und Albrecht mit König Ludwig dem Bayern eine definitive Beilegung des nun schon 15 Jahre dauernden Konflikts zu suchen. Bereits am 6. August 1330 kam es zum Vertrag von Hagenau, in dem der König den beiden Habsburgern für ihre Dienste die Reichsstädte Zürich, Schaffhausen, St. Gallen und Rheinfelden verpfändete. Das bedeutete für Zürich eine unmittelbare Bedrohung, die Gefahr, in den habsburgischen Machtbereich integriert zu werden und den Status als Reichsstadt längerfristig zu verlieren. Schaffhausen wird erst 1415 wieder den Ausstieg schaffen, Rheinfelden gar nicht mehr. Die Stadt Zürich konnte sich zwar wie St. Gallen innert kurzer Zeit aus der Verpfändung freikaufen, ein gutes Einvernehmen mit Habsburg-Österreich blieb aber wichtig. Die Herzöge Otto und Albrecht riefen 1333 einen allgemeinen Landfrieden aus, dem neben vielen anderen auch die Städte Bern und Zürich beitraten. Mit Baden, Winterthur, Regensberg, Zug und den Laufenburgern in Rapperswil hatte Habsburg-Österreich zahlreiche starke Positionen rund um Zürich inne.
Auch im Westen stehen die Zeichen für Habsburg-Österreich günstig. Nach dem Laupenkrieg zwischen Bern und dem burgundisch-kyburgischen Adel 1339 und der Anfang August 1340 in Königsfelden von Agnes von Ungarn angeleiteten Versöhnung begibt sich auch die Reichsstadt Bern Ende November 1341 in ein Bündnis mit Habsburg-Österreich. Schultheiss Johann II. von Bubenberg nutzt diese Situation, indem er sich die umstrittene Herrschaft Spiez definitiv als habsburgisches Lehen sichert. Ende 1347, nach dem Tod von König Ludwig dem Bayern, erneuern die Berner das Bündnis mit Habsburg. In den unsicheren Zeiten nach dem Tod eines Königs erscheint es den Bernern angebracht, sich mit der neben Savoyen im Südwesten wichtigsten Regionalmacht, eben den Habsburgern, die auch Herren der Nachbarstadt Freiburg sind, gut zu stellen.
Das hegemoniale Netz von Habsburg-Österreich im Mittelland ist in diesen Jahren eng geknüpft. Die starken Adelsparteien in den Städten Zürich und Bern stehen dem habsburgischen Dienstadel nahe. In Luzern, das seit dem Frühling 1291 zu Habsburg gehört, sich aber seit 1332 den Innerschweizer Ländern deutlich angenähert hat, existieren ebenfalls noch starke Beziehungen zu Habsburg-Österreich. Schwyz und die Waldstätte stehen nach den Konflikten um das Kloster Einsiedeln und dem Gefecht am Morgarten seit 1318 in einem Waffenstillstand mit den Habsburgern und verlängern diesen auch 1336, nach Unruhen in der Stadt Luzern, im Jahr des Umsturzes in Zürich.
So präsentiert sich die politische Grosswetterlage Ende der 1340er-Jahre. Es ist jedoch ein äusserst labiles Gleichgewicht, das innert kürzester Zeit wieder aus den Angeln gehoben wird. Rudolf Brun und Agnes von Ungarn spielen dabei erneut zentrale Rollen im Konflikt, der 1350 zwischen der Stadt Zürich und Habsburg-Österreich ausbricht. Nicht zu unterschätzen als Hintergrund der politischen Umwälzungen dieser Jahre ist aber auch die verheerende Pestepidemie, die 1348/49 durch Mitteleuropa zieht und auch in Städten und Ländern des Mittellandes gravierende Auswirkungen hat. Konkrete Folge davon sind massive Judenverfolgungen, auch in Zürich. In der Stadt selbst herrscht nicht nur deswegen grosse Unruhe. Das Brun’sche Regiment in Zusammenarbeit mit den verschwägerten Mülnern hat in der Stadt verschiedene Konflikte aufbrechen lassen. Insbesondere eine Privatfehde der Mülner mit Basler Bürgern sorgt für grossen Ärger. Die Zürcher nehmen etwa 100 Basler und 70 Strassburger, die sich auf einer Wallfahrt nach Einsiedeln befinden, in Geiselhaft. Damit handelt sich Zürich die Feindschaft der elsässischen Städte ein. Viel Zündstoff ist vorhanden.