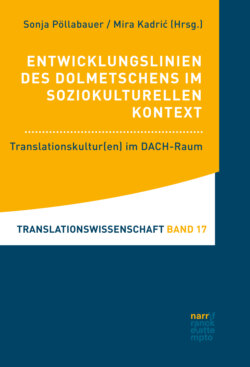Читать книгу Entwicklungslinien des Dolmetschens im soziokulturellen Kontext - Группа авторов - Страница 14
2 WandelTechnologieWandel durch Technologie
ОглавлениеIm Globalen Innovationsindex finden sich die deutschsprachigen Länder der DACH-Region auf den ersten Rängen wieder: Schweiz Rang 1, Deutschland Rang 7, Österreich Rang 13 (Global Innovation Index Report 2019:35) und im Allgemeinen wird Technologie überaus positiv wahrgenommen (vgl. Weltbank 2019:2). Trotzdem herrscht angesichts der zunehmenden Digitalisierung häufig Verunsicherung, insbesondere unter älteren Kollegen, was zu dem falschen Schluss führen könnte, Digitalisierung sei ein Generationenproblem. Die Fähigkeit, neue Technologien zu erlernen, sie kritisch zu hinterfragen und allenfalls erfolgreich einzusetzen, ist keine Frage des Alters. Sie darf nicht älteren Sprachdienstleistern, den sogenannten ‚digital migrants‘ pauschal abgesprochen werden und gleichzeitig den jüngeren Generationen, den mit digitalen Medien aufgewachsenen ‚digital natives‘, pauschal zugesprochen werden. Vielmehr liegt die Voraussetzung dafür in der Bereitschaft, sich Neuem zu öffnen und die entsprechenden Kenntnisse jeweils zu erarbeiten.
Geeigneter erscheint daher das DiffusionsmodellDigitalisierungDiffusionsmodell (Rogers 2003:247), das nach dem Zeitpunkt der Anwendung zwischen Innovator:innen, frühen Anwender:innen (‚early adopters‘), der Mehrheit (‚early and late majority‘) und Nachzügler:innen (‚laggards‘‚ ‚late adopters‘) unterscheidet. Innovator:innen bilden zunächst die kleinste Gruppe der Anwender:innen: Sie suchen Neues und sind bereit es auszuprobieren. Die frühen Anwender:innen entscheiden sich für einen Einsatz, sobald die Technologie Vorteile bringt, während die Mehrheit erst bei einem entsprechenden Erfolg der ‚early adoptors‘ zur Anwendung schreitet. Zeitpunkt und Ausmaß der Anwendung unterliegen verschiedenen subjektiven Kriterien: Die wahrgenommene Verbesserung gegenüber dem Bisherigen, die Vereinbarkeit mit den eigenen Erfahrungen und Anforderungen, die Komplexität der anzuwendenden Technologien, die Erprobbarkeit sowie die mediale Präsenz der Technologie (Rogers 2003:248).
Abb. 1:
Diffusionsmodell nach Rogers 2003:247
Vertikal gesehen sind die weltweit agierenden großen Sprachdienstleistungsunternehmen zu den Innovatoren bzw. zu den frühen Anwender:innen zu zählen. Oft sind sie auch zugleich die erfolgreichsten Softwareanbieter im Bereich der Translationstechnologie (zum Beispiel Lionbridge, SDL, Star-Group, u.a.). Mittelgroße und mittlere Anbieter:innen können der großen Mehrheit der Pragmatiker und Konservativen zugerechnet werden, während Nachzügler:innen und Skeptiker:innen eher unter den Einzelübersetzer:innen zu finden sind.
DigitalisierungDigitalisierungArbeitsplatz und Unterstützung durch den Computer haben sich historisch gesehen zuerst für das Übersetzen etabliert: Professionelles Übersetzen, Web- und Softwarelokalisieurng, Untertitelung sowie viele andere Bereiche des Übersetzens sind heute ohne digitale Werkzeuge nicht mehr denkbar (Biau-Gil & Pym 2006, Bowker & Corpas Pastor 2015, Cronin 2013, Sandrini 2017). Erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung haben sich auch für das Dolmetschen entsprechende Werkzeuge durchgesetzt, die den Menschen während und insbesondere vor der eigentlichen Dolmetschleistung unterstützen. Das computergestützte Dolmetschen (Computer Aided Interpreting CAI) (vgl. Ziegler 2019:310) wird von Fantinuoli (2018:5) in prozessorientierte TechnologieTechnologieprozessorientierte Technologie („designed to assist human interpreters in their work“), die direkten Einfluss auf das Dolmetschen hat, sowie in die sogenannte ‚settings-oriented technologyTechnologiesettingorientierte Technologie‘ unterteilt, die indirekt die Arbeit von Dolmetscher:innen beeinflusst („designed to change the way they deliver their service“), wie beispielsweise Telefon- oder Videodolmetschen.
Letztere hatte durch den Einsatz einfacher Technologie wie Mikrophon, Kopfhörer und Tonübertragung bereits sehr früh das professionelle Konferenzdolmetschen ermöglicht. Das ortsunabhängige Remote Interpreting (RI), durch Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglichte Dolmetschleistungen, definiert als „interpreter mediated communication delivered by means of information and communication technology“ (Fantinuoli 2018:4), begann mit Hilfe des TelefonsTelefondolmetschen als ‚Over-the-Phone Interpreting (OPI)‘. In einer Studie zum US-amerikanischen Markt verwendeten 68 % der befragten Dolmetschunternehmen solche Systeme (CSA 2018). Eine etwas geringere Verbreitung verzeichnete in derselben Studie das Video Remote Interpreting (VRI), das 58 % der Befragten benutzten. Technologischer Fortschritt in der Video- und Tonübertragung über das Web nach der Jahrtausendwende führte dazu, dass eine neue Qualität des RI erreicht werden konnte, das Remote Simultaneous InterpretingRemote Simultaneous Interpreting (RSI). Darunter versteht man eine virtuelle Dolmetschkabine mit geographisch unabhängigen Dolmetscher:innen, die Gespräche und Konferenzen in Echtzeit dolmetschen können. Ermöglicht werden dadurch virtuelle Konferenzen, bei denen sich neben Dolmetscher:innen Vortragende und Teilnehmer:innen räumlich unabhängig voneinander zu Konferenzen und Diskussionen zusammenfinden können. In der bereits zitierten US-Umfrage verwendeten 2018 lediglich 23 % diese Form der Unterstützung. Bis vor kurzem wurde noch darüber gestritten, ob diese Form des RI überhaupt zugelassen werden darf. Heute hingegen diskutieren Berufsverbände (zum Beispiel AIIC 2019) darüber, welche Standards dabei eingefordert bzw. wieweit bestehende Standards angepasst werden müssen (vgl. Fantinuoli 2018:5).
Auch in diesem Bereich sind die Innovator:innen bzw. die frühen Anwender:innen unter den großen Technologiekonzernen aus Kalifornien zu finden. So wurden RSI-Plattformen an Entwicklerkonferenzen dieser Unternehmen zum ersten Mal mediengerecht zur Anwendung gebracht: 2018 vom Dienstleistungsanbieter Interprefy.com, 2019 durch das Unternehmen KUDO an der Facebook Entwicklerkonferenz F8.