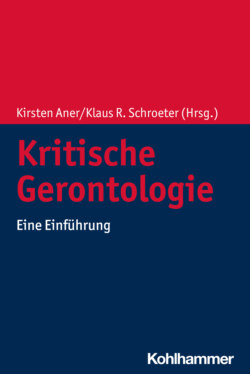Читать книгу Kritische Gerontologie - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 … zur Politischen Ökonomie des Alterns
ОглавлениеAuf der makrosoziologischen Ebene wurde das Alter unter der von Marshall und Tindal eingeforderten Perspektive der Political Economy of Ageing in den USA und Kanada vor allem von Caroll L. Estes, Meredith Minkler, John Myles, Laura Katz Olson und Jill Quadagno und in Europa insbesondere von Peter Townsend, Alan Walker und Chris Phillipson in England sowie in Frankreich von Anne-Marie Guillemard verstärkt in den Blick genommen.10 Sie alle haben mit ihren Studien wertvolle Pionierarbeit der Kritischen Gerontologie geleistet. Dabei ging es weniger um die Ausarbeitung einer eigenständigen Alternstheorie als vielmehr um die Nutzung des allgemeinen theoretischen Rahmens der Politischen Ökonomie, innerhalb dessen das Alter in einen unmittelbaren gesellschaftlichen Bezug und vor allem in den Kontext der Analyse sozialer Ungleichheiten und sozialer Klassenstrukturen gesetzt wurde.
In der Politischen Ökonomie des Alters wird das Alter vor allem unter dem Aspekt der ›sozialen Konstruktion von Armut und Abhängigkeit‹ (Walker, 1980, 1981) oder im Kontext der Theorie der ›strukturierten Abhängigkeit‹ (Townsend, 1979, 1981) als Produkt sozialer Strukturkräfte bzw. als Produkt des Marktes und der Ruhestand als »Euphemismus für Arbeitslosigkeit« (Townsend, 1981, S. 10) gesehen. Sowohl Townsend als auch Walker führen die Abhängigkeit älterer Menschen auf den erzwungenen Ausschluss älterer Menschen aus der Erwerbstätigkeit und auf die damit verbundenen Armutserfahrungen zurück.11 Die strukturelle Grundlage dafür sei die Abhängigkeit aller Arbeit vom Kapital, wobei die älteren Menschen besonders benachteiligt werden, weil ihnen – u. a. durch die Veränderungen in den Berufen und in der Arbeitsorganisation, in den industriellen Prozessen und technischen Entwicklungen und durch die Umstrukturierungen des Kapitals – der Zugang zu vielen Arbeitsplätzen verwehrt wird und sie auf eine Beschäftigung mit niedrigem Status beschränkt (Walker, 1981, S. 89).
Ein anderes prominentes Beispiel der Politischen Ökonomie des Alters ist die von Carroll L. Estes (1979, 1993) in den USA vorgelegte Forschung zum aging enterprise. Damit lenkt Estes die Aufmerksamkeit auf all die Organisationen und Institutionen, die im Gefolge des 1965 verabschiedeten ›Older American Act‹ entstanden und ein »Konglomerat von Programmen, Organisationen, Bürokratien, Interessengruppen, Wirtschaftsverbänden, Anbietern, Industrien und Fachleuten« umspannen, das auf der einen Seite zwar den »alten Menschen in der einen oder anderen Funktion dien[t]«, auf der anderen Seite aber auch als Beleg dafür steht, »wie die Alten in unserer Gesellschaft oft als Ware behandelt werden« (Estes, 1979, S. 2). Im Rekurs auf einen Beitrag über die Soziologie der Armut von Coser (1965) beschreibt Estes das Paradoxon des aging enterprise als wachsende Dienstleistungsindustrie, die sich der Erhaltung und dem Schutz der Unabhängigkeit und Normalität alter Menschen widmet, zugleich aber deren Abhängigkeit und Marginalität zum Überleben benötigt (Estes, 1979, S. 25).
In diesem Rahmen wurden in der Politischen Ökonomie des Alterns die Wechselbeziehungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen – a) finanzielles und postindustrielles Kapital und seine Globalisierung, b) Staat, c) Sex-/Gender-System,12 d) Öffentlichkeit und Bürger, e) medizinisch-industrieller Komplex, f) aging enterprise – untersucht (Estes 1999, 2001a). Dabei stehen vor allem das aging enterprise und der ›medizinisch-industrielle Komplex‹ (Estes et al., 2001a, 2001c; Estes & Binney 1989) als neu entstandene institutionelle Akteure, die zur Kommodifizierung von Gesundheit beigetragen und die Gesundheitsversorgung und Bedürfnisse älterer Menschen zu Wirtschaftsprodukten und gewinnbringenden Gütern transformiert haben, im Fokus der Betrachtung (vgl. Estes, 2001a, 2001c).