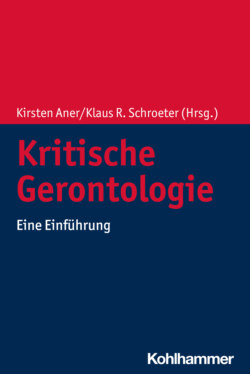Читать книгу Kritische Gerontologie - Группа авторов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kollaps der internalistischen Perspektive
ОглавлениеBaars unterstellt der »internalistischen Gerontologie«, dass sie von der Hoffnung lebe, dass das Sammeln riesiger Mengen von Daten irgendwann einmal – per se – ein schlüssiges Bild des Alternsprozesses liefere (ebd., S. 223). Diese »kanonische« Sichtweise sei von Maddox und Campbell (1985) im »Handbook of Aging« formuliert worden (ebd., Anm. 3):
»Wir sind in den Anfangsstadien eines Prozesses zur Datengewinnung, der schließlich einmal interkulturell, intertemporär und für alle Altersstufen vergleichbare Daten über das gesamte Leben oder wenigstens über große Teile kompletter Lebensläufe mit ergänzenden Zeitreihendaten auf der Makroebene liefern wird. Zweifellos wird die Form, die diese Datensets annehmen, teilweise motiviert durch die theoretischen Interessen derjenigen, die sie erheben, aber viele der Daten werden aus einem mehr oder weniger zufälligen Prozess administrativer oder akademischer Interessen resultieren.« (Maddox & Campbell, 1985, zit. nach Baars, 1991, S. 238)
Dies sei, so Baars, jedoch ein methodisch naives Echo auf die traditionelle positivistische Hoffnung, dass alle Disziplinen durch fortgesetzte logische und empirische Verfeinerung schließlich kumulatives und komplementäres Wissen über ihr Thema, in diesem Fall Altern, erlangen werden (ebd., S. 223).
Dass diese Hoffnung unberechtigt sei, begründet Baars im Folgenden, indem er die beiden tragenden Säulen des traditionellen »positivistischen«19 Ansatzes betrachtet. Eine sei die erkenntnistheoretische Annahme, dass die modernen Naturwissenschaften die glaubwürdigste Form empirischen Wissens, nämlich »objektives Wissen« lieferten, was durch ihre technologische Effektivität praktisch bewiesen sei. Die andere sei die Annahme, dass eine »objektive Realität« existiere, als ein und dasselbe zu allen Zeiten und an allen Orten und diese unabhängig von theoretischen Konstruktionen ist, sodass sie als objektiver Prüfstein für die Wissenserweiterung dienen könne, weshalb wiederum der Prozess der »methodologischen Klärung« (methodological purification) letztlich das wahre Wissen der Realität produzieren könne (ebd., S. 224). Der Prozess, in dem die Idee eines nicht kontaminierten »objektiven« Wissens zu bröckeln begann, ließe sich zurückverfolgen bis zu Poppers »Logik der wissenschaftlichen Erkenntnis« (1968 [1934]). Popper hätte lange an der Idee einer »objektiven Realität« festgehalten, während er gleichzeitig die fundamentale Bedeutung der Intersubjektivität in der Wissenschaft bestätigte (Baars, 1991, S. 226).20 Die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit müssten von der wissenschaftlichen Community überprüft werden. Jede Überprüfung (falsification) setze aber eine Theorie voraus, die die Falsifikation selbst erst möglich macht. Dieser Theorie würde eine logische Priorität eingeräumt und dies einzig durch eine Entscheidung – und nicht etwa, weil festgestellt wurde, dass diese Theorie die »objektive« Realität repräsentiert. Es könne daher keine Grundaussage geben, die unabhängig ist von einer sie umschließenden Theorie (enveloping theory), die man selbst nicht überprüfen kann. Solche Theorien könnten auch als Modelle, Standards oder nach Wittgenstein (1953) als »Paradigmen« bezeichnet werden (Baars, 1991, S. 226). Die Entscheidung für ein Paradigma sei also nicht rational zu begründen und seine orientierende und interpretative Funktion reiche weit über die Grenzen dessen hinaus, was empirisch festgestellt worden ist. In der Folge sei es auch unmöglich, methodische Regeln und soziale Faktoren streng voneinander zu trennen (ebd.). Es sei folglich Misstrauen gegenüber »rationalen« wissenschaftlichen Standards angesagt, das aber keineswegs in ein »anything goes« münden dürfe (ebd., S. 227). Mit anderen Worten: Es gelte, weder nach der absoluten Wahrheit zu fahnden noch der absoluten Indifferenz zu erliegen, sondern nach besseren Wegen für gerontologische Arbeit zu suchen. Der Disput über die relative Qualität von Erkenntnis(-prozessen) könne dabei jedoch nicht allein auf der methodischen Ebene entschieden werden (ebd.), wie Baars im Folgenden ausführlich begründet.