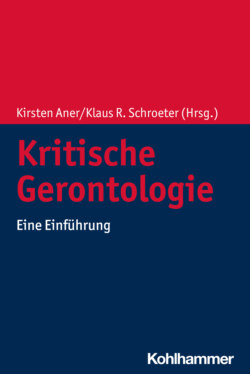Читать книгу Kritische Gerontologie - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Von der Radikalen Gerontologie …
ОглавлениеNicht zuletzt vor dem Hintergrund der weltweiten wirtschaftlichen Rezession nach dem sog. Ölpreis-Schock 1974 und der damit einhergehenden politischen und sozialen Verwerfungen entwickelte sich seit den späten 1970er und frühen 1980er Jahren ein Strang innerhalb der Gerontologie, der alsbald unter dem Namen der ›Kritischen Gerontologie‹ bekannt wurde.8 Ein früher Beitrag dazu sind die Überlegungen von Marshall und Tindale (1978) zur ›Radikalen Gerontologie‹. Sie kritisieren die Erhebungsmethodik der Gerontologie und deren Betonung der psychologischen Dispositionen in der Umfrageforschung, die die Aufmerksamkeit von den strukturellen Bedingungen ablenkt, die das Leben im Alter beeinflussen. Sie sehen die herkömmliche Gerontologie als ein sich auf den Einzelnen konzentrierendes »Bastelhandwerk« (tinkering trade), das darauf ausgerichtet sei, die Einzelnen an das bestehende System anzupassen (Marshall & Tindale, 1978, S. 165). Demgegenüber würde eine Radikale Gerontologie »die individualistischen und Anpassungsvorurteile vermeiden und anerkennen, dass das Leben in der Gesellschaft von Konflikten, Verhandlungen und Kompromissen über politisch-ökonomische und andere Interessen gekennzeichnet ist« (ebd., S. 163). Marshall und Tindale (ebd., S. 168) setzen die Radikale Gerontologie in Kontrast zur bisherigen angewandten Gerontologie und beziehen sich dabei auf die von Gouldner (1968) gezogene Differenzierung zwischen radikaler und liberaler Soziologie.9 Dementsprechend würde eine Radikale Gerontologie im Gegensatz zur angewandten Gerontologie positivistische Formulierungen ablehnen und eine »radikale Methodik« anwenden, wie sie u. a. im symbolischen Interaktionismus und in der phänomenologischen Gerontologie und Ethnomethodologie, aber auch in der marxistischen Soziologie diskutiert wird (Marshall & Tindale, 1978, S. 168). Dazu haben sie insgesamt neun Prämissen formuliert, von denen sich die ersten sechs auf eine kritische bzw. radikale Soziologie und die letzten drei auf die radikale Gerontologie beziehen (ebd., S. 167f.):
1. Ein Verständnis des Alterungsprozesses müsse ein Bewusstsein für den historischen Kontext einschließen, in dem der Einzelne alt geworden ist.
2. Dieser historische Kontext schließe soziale, politische und wirtschaftliche Realitäten ein, die individuelles und kollektives Handeln formen.
3. Soziale Prozesse seien nicht durch eine innere Tendenz zur Ausgeglichenheit gekennzeichnet.
4. Interaktionen zwischen Individuen, Gruppen und Klassen beruhen auf Interessenunterschieden, was zu Verhandlungen, Konflikten und Kompromissen führe und die Stabilität der Beziehungen zwischen Individuen und makroökonomischen Einheiten prekär mache.
5. Es könne nicht von einer unvermeidlichen Harmonie von Individuum und Gesellschaft und einem allgemeinen Wertekonsens ausgegangen werden.
6. Dementsprechend würde jede Sozialisation oder ›Anpassung‹ zu einer verzerrten Vorstellung von Wirklichkeit führen.
7. Alter und Altern sollen nicht durch theoretisch vorgegebene Kategorien betrachtet, sondern durch das Verständnis des Alterungsprozesses aus den Perspektiven und der Realität der Alten selbst abgeleitet werden.
8. Wenn die Interessen der Älteren in Konflikt mit den Interessen und Realitäten des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontextes geraten, dann sollte die radikale Gerontologie sich der Frage zuwenden, wie dieser gesellschaftliche Kontext an das alternde Individuum anzupassen wäre und nicht, wie das alternde Individuum an den gesellschaftlichen Kontext angepasst werden kann.
9. Gerontologen sollten sich explizit mit den Forschungsdilemmata auseinandersetzen, die sich aus der Diskrepanz zwischen der professionellen und unterstützenden Gruppe und der Gruppe der Forschungs-›Subjekte‹ – den alten Menschen – ergeben.
Marshall und Tindale (1978, S. 169) kritisieren, dass es in der herkömmlichen angewandten positivistischen Gerontologie vor allem Studien gibt, die (angeblich) für und nicht mit den älteren Menschen durchgeführt würden. Sie plädieren stattdessen für »mehr Forschung über die zwischenmenschliche Interaktion in face-to-face-Situationen« und für »die Verortung des Individuums in Bezug auf eine historisch verstandene Umwelt«. Zudem seien »mehr Studien über die politische Ökonomie des Alterns erforderlich, die unserem Verständnis des Lebens der heutigen Alten wieder einen Sinn für den Kontext geben und uns insbesondere über die sozioökonomischen Kräfte informieren, die die psychologischen Prozesse des Alterns beeinflussen« (ebd., S. 169f.).