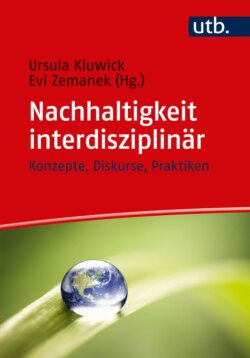Читать книгу Nachhaltigkeit interdisziplinär - Группа авторов - Страница 11
Die Grenzen des Wachstums
ОглавлениеDer zweite hier analysierte Grundlagentext wurde 250 Jahre später geschrieben: Die Grenzen des Wachstums von 1972.16 Das Buch geht auf die Initiative und finanzielle Unterstützung des Club of Rome zurück, der 1968 in Rom von Personen aus Wissenschaft und Politik gegründet wurde.17 Es wurde von einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfasst, die sowohl auf dem Cover als auch im Klappentext als „Mitarbeiter der berühmtesten westlichen Denkfabrik, des Massachusetts Institute of Technology (MIT)“18 vorgestellt werden.
In beiden Paratexten des Buchumschlags wird bereits das Ergebnis zusammengefasst:
Das Fazit ist eindeutig: Unser Bevölkerungs- und Produktionswachstum ist ein Wachstum zum Tode. Der ‚teuflische Regelkreis‘ – die Menschheitszunahme als Ursache und Folge der Ausplünderung unseres Lebensraums – kann nur durch radikale Änderung unserer Denkgewohnheiten, Verhaltensweisen und Gesellschaftsstrukturen durchbrochen werden.
Man müsse weiterhin auf Technik und Wissenschaft setzen, aber nicht mit dem Ziel, das Bruttosozialprodukt zu erhöhen. Vielmehr habe das Meadows-Team den „Zustand eines stabilisierten Gleichgewichts“ (Klappentext von Meadows et al. 1980) errechnet, den man noch erreichen könne.
An dieser Stelle setze ich nun wieder die fünf Kernaspekte ein, um das Verständnis von Nachhaltigkeit, wie es hier formuliert ist, zu konturieren und vergleichbar zu machen. Die Forschenden des MIT sind Systemtheoretiker und gehen von einem dynamischen Systemverständnis aus. Ihr Ziel ist es, ein Weltmodell aufzustellen, mit dem sich die globale Entwicklung berechnen lässt. Dazu stellen sie die aus ihrer Sicht zentralen Grundgrößen auf: „Bevölkerung, Kapital, Nahrungsmittel, Rohstoffvorräte und Umweltverschmutzung“ (Meadows et al. 1980: 76). Hier handelt es sich nicht nur um Ressourcen im engeren Sinn, sondern um andere Faktoren, die aus ihrer Sicht entscheidend die weltweite Entwicklung bestimmen.
Das Forscherteam betrachtet diese Grundgrößen als voneinander abhängige Variablen. Im Sinne des dynamischen Systemkonzepts werden sie als wechselwirkende Teile verstanden. Um solche Wechselwirkungen berechnen und hochrechnen zu können, braucht es auch hier eine Bezugseinheit: Das ist „die Menschheit“ (Meadows et al. 1980: 12), „die Erde“ (Meadows et al. 1980: 13) oder das Weltsystem, für das es dann entsprechend ein „Weltmodell“ (Meadows et al. 1980: 15) gibt. Außerdem wird jede Grundgröße für sich noch einmal als Regelkreis beschrieben mit Faktoren, die eine Zunahme begünstigen, und solchen, die zur Abnahme der Größe beitragen. Dieses Weltmodell übernehmen sie von Jay Forrester und dessen kybernetischem Ansatz der Systems Dynamics (Seefried 2015: 60, 267 f.). Mit den Grundgrößen, ihren Regelkreisen und den Daten, die dazu vorliegen, lassen sich Computerberechnungen anstellen und das Verhalten der Variablen zueinander testen.19 Der zeitliche Rahmen dazu wechselt, mal geht es um den „Zeitraum zwischen 1900 und 2100“ (Meadows et al. 1980: 79), mal bis zum Jahr 2000 oder auch deutlich länger.
Die Computersimulationen führen zu eindeutigen Ergebnissen, welche die Forscher als Anlass zu deren Publikation schildern: „Wir kamen dabei zu Erkenntnissen, wie sie sich schon vielen weiterblickenden Menschen aufdrängten: daß die kurzen Verdoppelungszeiten im System der Menschheit uns erstaunlich rasch an die Grenzen des Wachstums heranführen werden“ (Meadows et al. 1980: 75). Die Entwicklung vollziehe sich nicht nur exponentiell, sondern „super-exponentiell“ (Meadows et al. 1980: 26). „Dieses Systemverhalten tendiert eindeutig dazu, die Wachstumsgrenzen zu überschreiten und dann zusammenzubrechen“ (Meadows et al. 1980: 111), so die Forscher des MIT. Das habe ihre „Wertmaßstäbe verändert“.20
Diese Dynamik lässt sich an folgender Grafik ablesen (vgl. Abb. 2). Für alle Grundgrößen sind die Daten zwischen 1900 und 1970, die zu dieser Zeit vorliegen, eingetragen – danach wird die Kurve durch Hochrechnungen ergänzt. Man sieht, wie bis 2020 Nahrungsmittel, Industrieproduktion, aber auch Umweltverschmutzung und Bevölkerung steigen – nur die Rohstoffvorräte fallen. Um 2050 gibt es dann einen Wendepunkt und deutlichen Abfall der Bevölkerungszahlen. Das Wissen wird hier über Computersimulationen gewonnen. Ausgehend von Daten zu Grundvariablen eines Systems und deren Interaktion werden zukünftige Entwicklungen hochgerechnet und in Graphen visualisiert. Dies bedeutet allerdings „die Abhängigkeit des Erkenntnisfortschritts von der Leistungsfähigkeit der Rechner“ (Gramelsberger 2010: 95).
Abb. 1: aus: Meadows et al. 1980: 113.
Die Forscherinnen und Forscher des MIT formulieren den Anspruch, ihr Modell sei „das einzige existierende Modell, das wirklich weltweite Bedeutung hat“ (Meadows et al. 1980: 15). Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie über einen der zu dieser Zeit wenigen Computer mit entsprechender Rechenkapazität verfügten.21 Der Vorteil ihres Modells ist außerdem, dass man mit ihm experimentieren kann, indem man die Variablen ändert und dann die Auswirkungen dieser Änderungen in Probeläufen durchspielt (vgl. Gramelsberger 2010: 157). Diese informationstechnologischen Möglichkeiten prägen auch die Weltwahrnehmung: „Computer geben Einblicke in das Innere der Phänomene, indem sie das gesamte Gebiet der Mannigfaltigkeiten als mathematischen Möglichkeitsraum eröffnen“ (Gramelsberger 2010: 255).
Abb. 2: aus: Meadows et al. 1980: 13.
Wie sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst positionieren – auch im Verhältnis zu den anderen Menschen –, zeigt eine Grafik, die im Anfangsteil des Buches abgebildet ist (vgl. Abb. 2). Sie wirkt wie eine nüchterne wissenschaftliche Grafik. Die darauf eingetragenen Punkte könnten errechnet sein, bei genauerem Betrachten wirken sie jedoch grob gesetzt – beim Verfertigen schien es eher um die Veranschaulichung eines allgemeinen Prinzips gegangen zu sein. Dennoch referiert die Grafik stilistisch auf das ‚Genre‘ mathematisch-exakter Darstellungen.
Die beiden Achsen stellen Raum und Zeit dar. Auf den Achsen sind nun jeweils durch Striche markierte Zonen eingetragen. Die Beschriftung weist sie aus als „Familie“, „Arbeit, Stadt, Nachbarschaft“, „Nation“, „Erde“ (Meadows et al. 1980: 13). Auf der Zeitachse gibt es die Abschnitte „kommende Woche“, „nächste Jahre“, „Lebensspanne“, „Lebensspanne der Kinder“.22 Im Text wird dazu erläutert, dass es sich bei den Punkten um die menschlichen Belastungen oder Sorgen handele. Je nachdem, wo der „Zentralpunkt jeder menschlichen Sorge […] in dieses Koordinatensystem eingetragen“ (Meadows et al. 1980: 12) sei, beziehe sie sich auf zeitlich und räumlich Naheliegendes oder Ferneres.
Die Sorgen der meisten Menschen konzentrieren sich in der linken unteren Ecke; dieser Teil der Menschheit hat ein schweres Leben; er hat sich fast ausschließlich darum zu bemühen, sich und seine Familie über den nächsten Tag zu bringen. Andere wieder können über den Tag hinaus denken und handeln. Sie empfinden nicht nur eigene, sondern auch Lasten der Gemeinschaft, mit der sie sich identifizieren. Ihre Handlungsziele erstrecken sich über Monate und Jahre. (Meadows et al. 1980: 12)
Zunächst einmal ist die letzte Bezugseinheit die Menschheit – die Grafik ist untertitelt mit „Aussichten der Menschheit“ (Meadows et al. 1980: 13). Diese Einheit wird in sich differenziert, es werden verschiedene Rollen verteilt. Diese Differenzierung sei keine normative, sondern eine, die sich objektiv nach rein mathematisch berechenbaren Kriterien richte – das suggeriert die Darstellungsweise der Grafik. Die Menschen werden danach eingeteilt, wie weitsichtig sie denken und handeln können, sowohl zeitlich als auch räumlich gesehen. Demnach sind links unten diejenigen verortet, die zeitlich wie räumlich begrenzt denken und handeln. Daher rührt die Qualifikation, dass sie „ein schweres Leben“ hätten. Auch der nächstliegende Teil der Menschheit empfinde „Lasten“, aber sie bezögen sich eben auf weitere Kreise, wie die „Nation“, und auch zeitlich werde in längeren Zeitspannen gedacht und gehandelt.
Nun steckt implizit bereits in dieser Grafik eine weitere Rolle: die Selbstverortung der Beschreibenden. Dies ist die Einleitung in einen Bericht, der den Zustand der Menschheit bzw. der Erde beschreiben und dabei Berechnungen anstellen möchte, wie diese sich über die nächsten Jahrhunderte entwickeln werden. Die Forscherinnen und Forscher gehören folglich, wie sie dann auch selbst schreiben, „in die obere rechte Ecke des Koordinatensystems von Abbildung 1“ (Meadows et al. 1980: 14). Es handelt sich um die Wenigen, die in der Lage sind, auf die größtmögliche räumliche Einheit – die Erde, die Menschheit oder den Planeten – und eine langfristige Zeitspanne – von „Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten“ (Meadows et al. 1980: 15) – bezogen zu denken und Handlungsvorschläge zu machen, also den „langfristigen weltweiten Problemen“ (Meadows et al. 1980: 15) nachzugehen.23
Das Verständnis von Nachhaltigkeit in den Grenzen des Wachstums ist am Ideal des Gleichgewichts ausgerichtet:
Wir suchen nach einem Modellverhalten, das ein Weltsystem repräsentiert, das 1. aufrechterhaltbar [sustainable] ist ohne Tendenz zu plötzlichem unkontrolliertem Zusammenbruch und 2. die Kapazität besitzt, die materiellen Bedürfnisse der Weltbevölkerung zu befriedigen.24
Ein entsprechendes Modellverhalten sähe so aus, dass sich die verschiedenen Größen wechselseitig und innerhalb ihres Regelkreises in einem systemischen Gleichgewicht halten (vgl. Abb. 3). Auch wenn sie in Form ‚nüchterner‘ Graphen dargestellt werden, so handelt es sich dennoch um zwei völlig verschiedene, aber durchaus drastische Zukunftsszenarien, die hier einander gegenübergestellt werden: den ‚Kollaps‘ des Weltsystems und das systemische Gleichgewicht.25