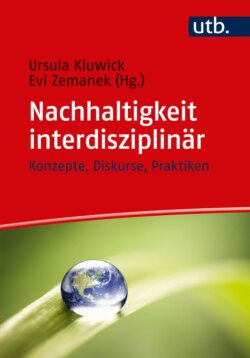Читать книгу Nachhaltigkeit interdisziplinär - Группа авторов - Страница 18
Konzepte und Modelle von Nachhaltigkeit
ОглавлениеDer Begriff der Nachhaltigkeit ist selbst Gegenstand einer kontroversen Debatte. Im Journalismus etwa wird ihm vorgeworfen, er fungiere als Leerformel oder Worthülse, die inhaltlich beliebig ausgedeutet werden könne (Bojanowski 2014). Vor diesem Hintergrund ist es eine der wesentlichen Herausforderungen für die Nachhaltigkeitskommunikation, die Idee der Nachhaltigkeit und ihre praktische Relevanz und konkrete Konsequenz für gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu schärfen. Anhand von drei Modellen soll im Folgenden knapp skizziert werden, welch unterschiedliche Debatten über eine gerechte und ökologisch verträgliche Gestaltung einer lebenswerten und lebensfähigen Zukunft unter dem Begriff der Nachhaltigkeit geführt werden.
Das am weitesten verbreitete Modell von Nachhaltigkeit ist das sogenannte „Drei-Säulen-Modell“ nachhaltiger Entwicklung. Dieses wurde Mitte der 1990er popularisiert, maßgeblich durch die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen Bundestages. Als Ziel einer nachhaltigen Entwicklung sieht es die gleichberechtigte und gleichwertige Verbesserung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem vor. Als ein Verdienst dieses Modells kann gelten, dass es die integrative Betrachtung verschiedener Entwicklungsdimensionen greifbar und einprägsam verkörperte. Diese illustrierende Funktion kann jedoch zugleich auch als die große Schwäche dieses Modells gelten: Sowohl die Anzahl der „Säulen“ als auch ihr Verhältnis zueinander wurden in der Folge zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Warum etwa stellt die Wirtschaft eine eigene „Säule“ dar, die Politik oder die Kultur jedoch nicht? In der Literatur finden sich als Ergebnis dieser Diskussion zahlreiche Vorschläge zur Erweiterung der drei Säulen („X-Komponenten-Modelle“): vom Lüneburger Vier-Säulen-Modell (Stoltenberg/Michelsen 1999), das die Kultur hinzufügt, über Fünf-Säulen-Modelle wie bei der Bund-Länder-Kommission (BLK 1998), die zusätzlich eine globale Dimension fordert, bis hin zum sechszackigen Stern beim Osnabrücker Erziehungswissenschaftler Gerhard Becker (Becker 2017), der die klassischen drei Säulen um Bildung, Gerechtigkeit und Partizipation erweitert. Hinter diesen Modellvorschlägen stecken aufgeladene Debatten – nicht nur darüber, wie viele Dimensionen zu berücksichtigen sind, sondern auch darüber, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen: von der klassischen Metapher der nebeneinanderstehenden „Säulen“, über Schnittmengenmodelle bis hin zu Teilmengenbeziehungen (siehe Abb. 1).
Abb. 1: Evolution von Modellen einer nachhaltigen Entwicklung.
In der Tat hat es lediglich der geringste Informationsgehalt des Drei-Säulen-Modells zu breiterer Bekanntheit gebracht, nach dem es bei der Nachhaltigkeit ‚irgendwie‘ um Umwelt, das Soziale und die Wirtschaft geht. Das unverbundene Nebeneinander dieses ‚Irgendwie‘ haben Karl-Werner Brand und Georg Jochum (Brand/Jochum 2000) einst zu dem schönen polemischen Bild des dreispaltigen Wunschzettels inspiriert, in dem jeder Akteur seine Interessen unterzubringen vermag. Aus der Kritik der bloßen Addition von Aspekten entstand insbesondere in der unternehmerischen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit das Triple-bottom-line-Modell, das nachhaltige Entwicklung in der Schnittmenge der drei Dimensionen verortete: Nachhaltig ist Entwicklung nur dann, wenn sie nicht isoliert einer Dimension diene, sondern allen (Elkington 1997).
Dem gegenüber sehen Teilmengenmodelle eine Gewichtung oder Hierarchisierung der Dimensionen vor: Insofern sich gesellschaftliche Entwicklung innerhalb ökologischer Systeme vollziehe und das Wirtschaften der gesellschaftlichen Entwicklung diene, sehen entsprechende Modelle diese Systeme als ineinander eingebettet an. Das vielleicht jüngste, inzwischen weit verbreitete Modell ist der sogenannte Oxfam-Doughnut, benannt nach der britischen Nichtregierungsorganisation Oxfam in Anlehnung an die Form eines Donuts. Die für Oxfam tätige Ökonomin Kate Raworth schlug anlässlich der UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung Rio+20 im Jahr 2012 vor, Nachhaltigkeit als einen Korridor zu verstehen. Entwicklung müsse, um nachhaltig zu sein, zum einen gewährleisten, unterhalb planetarischer Belastungsgrenzen zu bleiben, um die Stabilität und Tragfähigkeit ökologischer Systeme nicht zu gefährden (Raworth 2012). Sie müsse zugleich aber auch sicherstellen, dass ein Mindestmaß sozialer Grundsicherungen vorhanden ist, das es allen Menschen ermöglicht, ein gutes Leben zu führen. Der durch entsprechende Mindeststandards (untere Begrenzung) und entsprechende Maximalstandards (obere Begrenzung) bestimmte Korridor stelle den Handlungsraum für eine gleichermaßen sichere und gerechte Entwicklung der Menschheit dar. Bedeutsam an diesem Korridormodell erscheint, dass die Wirtschaft hier nicht länger als eine eigene Dimension oder Säule betrachtet wird, sondern als eine von mehreren Voraussetzungen für ein gutes menschliches Leben aufscheint, ansonsten aber keinen Eigenwert mehr darstellt.
Die vier knapp skizzierten Modelle eines Nachhaltigkeitsverständnisses machen bereits deutlich, wie sehr sich Vorstellungen unterscheiden können, etwa im Hinblick darauf, welcher Nachhaltigkeitsdimension sie Vorrang einräumen oder welches Gerechtigkeitskonzept ihnen zugrunde liegt. Auch können in Nachhaltigkeitsdiskussionen ganz unterschiedliche Vorstellungen von gesellschaftlichen Veränderungs-bedarfen zum Ausdruck kommen: solche, die nachhaltige Entwicklung innerhalb bestehender Strukturen für möglich halten (Status quo), solche, die grundsätzliche Reformen für nötig halten, ohne allerdings bestehende Strukturen vollständig infrage zu stellen (Reform), und solche, die eine radikale Transformation bestehender Wirtschafts- und Herrschaftsordnungen für nötig erachten (Transformation) (Hopwood/Mellor/O’Brien 2005). Eine weitere einflussreiche Unterscheidung von Nachhaltig-keitsverständnissen stammt von den Greifswalder Umweltethikern Konrad Ott und Ralf Döring (2004). Ott und Döring fragen danach, was erhalten (sustained) und was entwickelt (developed) werden soll, und betrachten dabei insbesondere die Frage der Austauschbarkeit von Naturkapital durch andere Kapitalarten wie z. B. Humankapital oder Sachkapital. Positionen, die von der Erhaltung bzw. Vermehrung des Gesamtkapitals ausgehen und dieses als nachhaltig betrachten, dabei aber den Austausch von Naturkapital (bspw. Aussterben von Pflanzen- und Tierarten) durch Sachkapital (neue medizinische Behandlungsmethoden) als legitim betrachten, bezeichnen Ott und Döring als „schwache“ Nachhaltigkeit. Demgegenüber gehen Positionen „starker“ Nachhaltigkeit davon aus, dass das Naturkapital einen Eigenwert besitze, um seiner selbst willen zu schützen und zu vermehren sei und daher nicht durch andere Kapitalarten ausgetauscht werden dürfe (vgl. Kap. 14/Meireis). Auch wenn diese Perspektive auf den ersten Blick abstrakt und lebensfern wirkt – bei vielen Konflikten (Naturschutz vs. wirtschaftlich-technologische Entwicklung, etwa beim Bau einer neuen Flughafenlandebahn im Lebensraum seltener Tierarten) sind es genau diese Fragen und Konflikte, die eine Rolle spielen.
Nachhaltigkeitskommunikation als Teil der Nachhaltigkeitswissenschaft beschäftigt sich somit zusammenfassend damit, wie Menschen sich mit den aufgeworfenen Fragen auseinandersetzen und sich miteinander über sie austauschen, welche Vorstellungen von Mensch-Natur-Verhältnissen und erstrebenswerten Zukünften sie dabei entwickeln und wie sich die Verständigung darüber fördern lässt, um den gesellschaftlichen Such-, Lern- und Gestaltungsprozess einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.