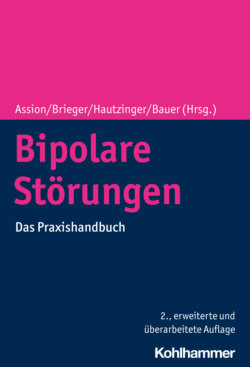Читать книгу Bipolare Störungen - Группа авторов - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Molekulare Genetik 3.2.1 Kopplungs- und Assoziationsuntersuchungen
ОглавлениеIn der molekularen Genetik unterscheidet man im Wesentlichen Kopplungsuntersuchungen und Assoziationsuntersuchungen. Bei Kopplungs- oder auch »Linkage«-Untersuchungen wird geprüft, ob bestimmte Varianten genetischer Marker in Familien nur oder überzufällig häufig bei den Erkrankten auftreten. Kopplungsstudien, die sozusagen ein Arbeitspferd der klassischen humangenetischen Analyse zur Kartierung von Krankheitsgenen darstellen, dominierten die psychiatrische Genetik von den 1980er Jahren bis zur Jahrtausendwende. Man unterscheidet hierbei zwischen parametrischen und nicht-parametrischen Kopplungsstudien.
Parametrische Kopplungsstudien basieren auf der Annahme spezifischer Parameter, wie z. B. der Monogenität der Erkrankung, eines spezifischen Vererbungsmodus (dominant oder rezessiv), der Penetranz und der Frequenz der Krankheit. Liegt für einen Befund die statistische »odds ratio« unter 1 : 1.000 bzw. der für parametrische Kopplungsuntersuchungen erhaltene LOD (Logarithm of odds)-Wert über 3, darf eine Kopplung mit dem betreffenden Locus angenommen werden, und man kann davon ausgehen, dass in der Nähe dieses Markers ein Veranlagungsgen zu finden ist. Als zuverlässig replizierte Kopplungsbefunde gelten Loci mit einem initialen LOD-Wert von über 3,3 (signifikant) und LOD-Werten von über 1,9 (suggestiv) in nachfolgenden Studien (Lander und Kruglyak 1995). Eine alternative und von Programmen wie GENEHUNTER verwandte Methode der Kopplungsuntersuchung ist die nicht-parametrische Linkage-Analyse, bei der der zugehörige Z-Wert oder NPL (non parametric)-Score nicht auf einem monogen vererbten Krankheitsmodell und der Annahme der oben genannten Parameter basiert. Dieser Ansatz wurde bei komplex-genetischen Phänotypen wie psychischen Erkrankungen favorisiert, da man hier eben keine empirischen Angaben zu Parametern wie dem Erbgang oder der Penetranz machen kann.
Bei Assoziationsuntersuchungen vergleicht man die Häufigkeit des Auftretens von bestimmten Varianten eines a-priori Kandidatengens in einer Patientenstichprobe und einer Kontrollstichprobe. Wird der genetische Marker signifikant häufiger im Patientenkollektiv gefunden als bei den Kontrollen, kann man davon ausgehen, dass entweder die Variante selbst oder ein in der Nähe gelegener Polymorphismus eine Vulnerabilitätsvariante für die untersuchte Störung darstellt. Assoziationsuntersuchungen lassen sich in Form von Fall-Kontroll-Studien oder auch familienbasierten Studien, bei denen nicht-transmittierte Allelen der Eltern der betroffenen Patienten als sogenannte »interne Kontrollen« genutzt werden, durchführen. Familienbasierte Studien gelten gegenüber falsch-positiven Ergebnissen als weniger anfällig, da hier unerkannte ethnisch-bedingte genetische Unterschiede zwischen Fällen und Kontrollen die Ergebnisse verfälschen können (Problem der sogenannten »population stratification«). Kandidatengenstudien in Form von Fall-Kontroll-Studien oder familienbasierten Studien wurden ebenfalls von vielen Arbeitsgruppen gegen Ende des letzten Jahrtausends neben Kopplungsstudien als gängige Arbeitsmethode eingesetzt. Der Vorteil der Kopplungsuntersuchung liegt vor allem darin, dass sie im Gegensatz zu Assoziationsstudien ohne vorherige Hypothese auskommt. Assoziationsuntersuchungen können im Gegensatz zu Kopplungsstudien aber auch Gene mit kleinen Effektstärken detektieren.
Die Vervollständigung der Sequenzierung des menschlichen Genoms zur Jahrtausendwende und Fortschritte bei der sogenannten Hochdurchsatz-Genotypisierungstechnik haben die Forschungslandschaft und die eingesetzten Methoden entscheidend verändert. Sowohl Kopplungsstudien als auch Assoziationsstudien in Form von hypothesengeleiteten Kandidatengenstudien oder zur Feinkartierung von durch Kopplungsstudien identifizierten chromosomalen Risiko-Loci verloren innerhalb kürzester Zeit ihre Bedeutung und wurden von sogenannten genomweiter Assoziationsstudien (GWAS) abgelöst. GWAS untersuchen hypothesenfrei mehrere hunderttausend Marker auf eine Assoziation mit einem Phänotyp, wie z. B. der bipolaren Störung. GWAS werden mithilfe sogenannter Microarrays durchgeführt, die auf Einzelbasen-Polymorphismen (sogenannten single nucleotide polymorphims oder SNPs) basieren. SNPs spiegeln im menschlichen Genom häufig auftretende genetische Varianten wider; sie kommen im Durchschnitt einmal pro 1.000 Nukleotide vor. D. h., dass es etwa 4–5 Millionen SNPs im Genom eines Menschen gibt. Seltene Varianten, die eventuell nur in bestimmten Populationen vorkommen, können mit solchen SNPs allerdings nicht erfasst werden ( Kap. 3.2.2). Von GWAS verspricht man sich neben robusteren Befunden auch die Identifikation neuer Kandidatengene für komplex-genetische Erkrankungen.
Im Folgenden wird kurz die aktuelle Studienlage zu GWAS der bipolaren Störung dargestellt. Auf die Auflistung früherer Kopplungs- und Kandidatengenstudien wird verzichtet, da sich die überwältigende Anzahl der Befunde aus dieser Ära der psychiatrischen Genetik als nicht robust herausgestellt hat. Der Grund hierfür lag v. a. an den geringen Fallzahlen. Galten in den 1990 Jahren Fall-Kontrollstudien mit einem kombinierten Stichprobenumfang von einigen Hundert Personen als »groß«, basieren moderne GWAS mittlerweile auf Stichprobengrößen von mehreren zehntausend Personen. Da GWAS eine große Anzahl von SNPs und damit viele Hypothesen testen, genügt ein traditionell akzeptierter Fehler erster Art (p-Wert) von 0,05 zur Erreichung von Signifikanz allerdings nicht mehr. Um bei einer GWAS von einem signifikanten Befund zu sprechen, muss ein Marker ein Signifikanzniveau von p < 5x10-8 erreichen, die sogenannte genomweite Signifikanz.
Die Tabelle 3.1 zeigt die chronologische Entwicklung der GWAS der bipolaren Störung über die letzte Dekade hinweg. Aufgeführt sind all diejenigen GWAS, die genomweit signifikante Befunde gezeitigt haben und sich auf den Phänotyp bipolare Störung (bipolar I, bipolar II und schizoaffektiv-bipolar) konzentrieren. Z. T sind einige Studien weiterhin auf bestimmte Subtypen eingegrenzt, z. B. bipolare Störung mit psychotischen Merkmalen. Somit sind Studien, die gezielt transdiagnostisch arbeiten (z. B. alle affektiven Störungen oder bipolare und schizophrene Störung zusammen betrachtet), nicht aufgeführt. Hierzu gibt es im Rahmen der Cross Disorder Workgroup des Psychiatric Genomic Consortium (PGC) eine eigene Forschungsrichtung (Cross-Disorder Group of the PsychiatricGenomics Consortium 2019).
Tab. 3.1: Genomweit signifikante Befunde bei der bipolar affektiven Störung
StudieEthnizitätStichprobengröße (Anzahl bipolare Patienten/Kontrolle) Kollektiv 1*Stichprobengröße (Anzahl bipolare Patienten/Kontrolle) Kollektiv 2*Gen(region)#
* Die oben aufgeführten Studien verfolgen unterschiedliche methodische Ansätze. Manche untersuchen nur ein Kollektiv, andere untersuchen dann in einem zweiten Replikationskollektiv nur die Marker, die im ersten Kollektiv eine vorher definierte Schwelle überschritten haben. Wieder andere führen beide Kollektive zusammen und analysieren dann in diesem größeren Kollektiv die besten Marker. Schließlich werden in manchen Studien, v. a. denen neueren Datums, beide Kollektive meta-analytisch untersucht. Eine gute detaillierte Übersicht hierzu findet sich bei Gordovez und McMahon (2020).
# Aufgeführt sind die Gene/Genregionen, in denen oder in deren enger physikalischer bzw. funktionaler Nähe SNPs mit einem genomweit signifikanten p-Wert gefunden wurden (in alphabetischer Reihenfolge)
Aus dieser Aufstellung lässt sich die Bedeutung der Konsortialforschung für die Identifizierung von Suszeptibilitätsgenen genetisch-komplexer Erkrankungen wie der bipolaren Störung unschwer erkennen. Mit größeren Stichproben, die nur durch große Kooperationen erzielt werden können, steigt die Chance, eine Vielzahl von assoziierten Varianten zu finden. Die Stichprobe der aktuell größten und bisher noch unveröffentlichten GWAS zur bipolaren Störung des internationalen Psychiatric Genomcis Consortium (PGC; https://www.med.unc.edu/pgc/) umfasst 41.917 Patienten und 371.549 Kontrollpersonen und testet 7,6 Millionen SNPs. Sie beschreibt genomweit signifikante Befunde für insgesamt 64 SNP-Marker, wovon 35 erstmalig beschrieben werden. Wie bei allen GWAS sind die Effekte von einzelnen SNPs für sich allein betrachtet verschwindend gering. Die Bedeutung der identifizierten Marker muss im Zusammenspiel untereinander (polygene Ätiologie mit Gen-Gen-Interaktionen) und mit Umweltfaktoren ( Kap. 3.2.3) gesehen werden. Obwohl auch die polygene Betrachtung, d. h. die gemeinsame Wirkung, aller identifizierter Varianten zur Aufklärung der phänotypischen nur einen einstelligen Prozentsatz beiträgt und damit ein Großteil der genetischen Grundlagen noch seiner Entdeckung harrt, können alle in einer GWAS untersuchten SNPs, d. h. nicht nur die genomweit assoziierten, auf der Grundlage ihres Beitrags zu einem Phänotyp gewichtet und zur Bildung eines Risikoscores, eines sogenannten polygenic risk score oder polygenic profile scores verwendet werden, der wiederum als Variable in weiterführenden Analysen verwendet werden kann ( Kap. 3.2.4).
Neben der Verwendung eines solchen polygenen Ansatzes lohnt sich aber weiterhin ein genauer Blick auf die assoziiert gefundenen Varianten. Auch wenn jedes implizierte Gen für sich allein genommen nur einen verschwindend geringen Bruchteil zur Varianz des Phänotyps beiträgt, lässt eine genaue Betrachtung einzelner Gene die Vielzahl der möglichweise an der Ätiopathogenese beteiligten Mechanismen erahnen und in detaillierten neurobiologischen Analysen im Tiermodell oder in modernen Stammzellstudien, z. B. in aus induzierten pluripotenten Stammzellen gezüchteten Organoiden (»mini brains«), modellieren. So ist ANK3 (Schulze et al. 2009) z. B. an der Bildung axonaler Myelinierung beteiligt. CACNA1C kodiert einen L-Typ spannungsabhängigen Ionen-Kanal mit bereits gut erforschten Funktionen im Bereich der neuronalen Entwicklung und synaptischen Übertragung.TRANK1 kodiert ein Protein, welches möglicherweise eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Bluthirnschranke spielt. Viele der anderen assoziiert gefunden Gene zeigen weitere ZNS-nahe Funktionen von ähnlicher Relevanz auf und lohnen eine individuelle Entdeckungsreise, die durchzuführen den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde.