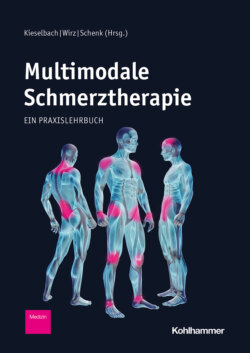Читать книгу Multimodale Schmerztherapie - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Entstehung und Entwicklung interdisziplinärer multimodaler Behandlungskonzepte
ОглавлениеSchon Bonica war davon überzeugt, dass »deutlich mehr Forschung notwendig ist […] und dass das Verständnis für relevante Schmerzsyndrome eine multidisziplinäre/interdisziplinäre Anstrengung eines Teams von sowohl Wissenschaftlern als auch Klinikern erfordert, die ihre individuellen Kenntnisse und Fertigkeiten zu Studien beitragen.« (Bonica 1990, S. 370; Übersetzung Kieselbach). Obwohl Bonica weiterhin intensiv in Wissenschaft und Lehre über die multi-/interdisziplinäre Vorgehensweise berichtete, wurde sein Konzept der Interdisziplinarität über fast zwei Dekaden hinweg ignoriert (Bonica 1990). Es fehlte das Verständnis dafür, dass es sich bei chronischem Schmerz meist um eine komplexe eigenständige bio-psycho-soziale Erkrankung handelt, die ein ebenso komplexes therapeutisches Vorgehen erfordert. Auch Gerbershagen, der Gründer der ersten Schmerzklinik in Deutschland, wies später auf diese Problematik hin (Gerbershagen 2003, S. 304): »Allerdings verstanden die Schmerzspezialisten selten die Bedeutung der Gleichzeitigkeit und der Gleichwertigkeit der somatischen, psychischen und sozialen Bedingungsfaktoren in der Diagnostik und Therapie des chronischen Schmerzes und sicher nicht, dass alle bestehenden Schmerzbilder gleichzeitig behandelt werden müssen, wenn zufriedenstellende Langzeitergebnisse erzielt werden sollen.« Erst das steigende Interesse am Phänomen Schmerz Anfang der 1970er Jahre führte zu einem erheblichen Zuwachs an interdisziplinären Einrichtungen zur Schmerzversorgung.
Erste Klassifikationen für schmerzversorgende Einrichtungen und multimodale Programme seit Ende der 1970er Jahre.
In den Jahren 1977–79 wurden die zu dieser Zeit existierenden schmerzversorgenden Einrichtungen vom »Committee on Pain Therapy« der Amerikanischen Gesellschaft der Anästhesisten (ASA) analysiert und kategorisiert, sodass das »International Directory of Pain Centers/Clinics«, ein Verzeichnis aller Schmerzzentren/-einrichtungen (sog. Oryx-Verzeichnis; APS-AAPM-Verzeichnis) und deren Klassifikation, entstand (Carron 1979, Gerbershagen 2003):
1. Überregionales Schmerzzentrum
2. Regionales Schmerzzentrum
3. Syndrom-bezogenes Schmerzzentrum/-einrichtung, inklusive Akutschmerz-Abteilungen
4. Verfahrens-orientiertes Schmerzzentrum/-einrichtung
Die dazu gehörigen Programme wurden fünfstufig subklassifiziert:
1. Großes übergeordnetes multidisziplinäres Programm; mehr als sechs beteiligte Disziplinen; Behandlung unterschiedlicher Schmerzsyndrome; Forschung und Lehre; universitär
2. Übergeordnetes, multidisziplinäres Programm; mind. 4–6 beteiligte Disziplinen; weitere wie 1.
3. Kleines multidisziplinäres Programm; 2–3 Disziplinen
4. Syndrom-orientiertes Programm, auf die Behandlung von Patienten mit speziellen Schmerzerkrankungen spezialisiert
5. Verfahrens-/Modalitäten-orientiertes Programm, Verwendung von einzelnen Verfahren
Im Anschluss an diese ersten Vorschläge für eine Klassifikation folgten weitere Definitionen der International Association for the Study of Pain (IASP) und der damaligen Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS) und heutigen Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.
Die sog. »Task Force« der IASP formulierte 1990 Richtlinien für die anzustrebenden Charakteristika von schmerztherapeutischen Versorgungseinrichtungen, die den aktuellen Vorschlägen der Ad-hoc-Kommission »Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie« der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. in ihren Grundsätzen bereits sehr ähnlich waren (Gerbershagen 2003, IASP 2009). Sie unterstrichen die multi-/interdisziplinäre Herangehensweise für Diagnostik und Therapie chronischer Schmerzsyndrome als zu präferierende Methode, um die Gesundheitsversorgung chronischer Schmerzpatienten zu gewährleisten. Die Überlegungen reichten sogar bis dahin, dass man sich fragte, ob schmerztherapeutische Einrichtungen, die nicht multi-/interdisziplinär arbeiten, weiterhin eine Existenzberechtigung haben sollten (Kröner-Herwig 2013).
Folgende Kriterien wurden von der »Task Force« der IASP vorgeschlagen:
• Therapeuten: umfangreiche professionelle Kenntnis, um der Diagnostik und Therapie der bio-psycho-sozialen Anforderungen chronischer Schmerzen gerecht zu werden
• Team: mind. zwei Ärzte (und/oder ein/e Psychiater/in), klinische/r Psychologe/in, Physiotherapeut/in, weitere (je nach Ausrichtung des Zentrums)
• Regelmäßige Besprechungen
• Organisation durch einen Zentrumsleiter
• Umfassende diagnostische und therapeutische Optionen: physikalisch-medizinisch, psychosozial, pflegerisch, physiotherapeutisch/ergotherapeutisch/sozialmedizinisch, je nach Ausrichtung weitere.