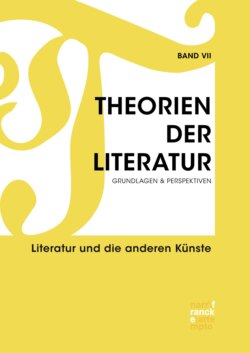Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 10
5. Gessner, Ligozzi und Camerarius
ОглавлениеIhrer Wirkung vermochte sich offenbar auch Konrad Gessner nicht zu entziehen, der den Eintrag über Krokodile in seinem Thierbuch mit zwei Holzschnitten illustrieren ließ, deren größerer ein Nilkrokodil mit einem wenn nicht gerollten, so doch S-förmig nach oben geschnellten Schwanz zeigt. Die Darstellung widerspricht zunächst Gessners Beschreibung der Tiere, die nach einem Überblick über die Nomenklatur in den europäischen Sprachen hauptsächlich antike Kenntnisse über äußere Merkmale, Verhalten, Verbreitung und Fortpflanzung auflistet, um anschließend auch Besonderheiten wie die Nutzbarkeit von Krokodilen in Küche und Pharmazie zu nennen. Unter den Merkmalen betont Gessner insbesondere die harte Panzerung der Krokodile mit Schuppen, die sie annähernd unverletzbar mache und auch den Schwanz überziehe. In der Kompilation aller verfügbaren Quellen bleiben Gessners Ausführungen selten ohne innere Widersprüche, und so bietet auch sein Kapitel über Krokodile einige Ungereimtheiten, denn auf die Beschreibung des Krokodils als panzerstarrendes Geschöpf folgt eine Szene, in der es ebenso grausam wie agil erscheint:
Aber wann die vom Hunger wütend werden/sollen sie sich so grausam erzeigen/daß sie mit einem Schlag ihres Schwanzes auch die allerstärcksten darnieder schlagen/und sie so dann im Grimm aufffressen.1
Auch wenn dieser Passus nicht behauptet, dass Krokodile ihre Schwänze wie auf den Bildern recken und rollen könnten, gibt er einen vagen Hinweis auf die mögliche Verbreitung entsprechender Vorstellungen; sie mag von den zeitgenössischen Bildern angeregt gewesen sein.
Zu den spektakulärsten Krokodildarstellungen dieser Zeit zählt ein Aquarell aus dem Besitz Erzherzog Ferdinands II.2 Das heute Jacopo Ligozzi zugeschriebene Blatt zeigt ein Krokodil in Seitenansicht vor einer Flusslandschaft. Die Merkmale des Krokodils sind naturnah erfasst, insbesondere die Zähne, die Nackenspalte sowie die mit Schwimmhäuten verbundenen Zehen des hinteren Beinpaars. Allerdings ist der Körper des Tiers caudal nach oben gerichtet; aus der Bewegung ergibt sich ein Schwung, in dem der Schwanz in anatomisch unmöglicher Enge nach vorne gebogen ist. Zwei Details scheinen das Tier in einen erzählerischen Zusammenhang zu setzen: In Hintergrund der Landschaft befindet sich eine antikisierend gestaltete Stadtansicht, den linken Vordergrund schließt hingegen ein Haufen menschlicher Knochen ab, darunter ein Schädel und eine Hand.
Das Bild zählte zu einem Konvolut von 100 Blättern, die Ferdinand II. bei Ligozzi in Auftrag gegeben zu haben scheint.3 Sie zeigen überwiegend adriatische Meeresfauna; die Tiere sind überwiegend in Seitenansicht vor neutralem Hintergrund oder allenfalls auf der Andeutung eines Sandstrandes angeordnet sind. Nur eine kleine Gruppe des Codex weist eine umfangreichere landschaftliche Einfassung auf. Wie die Zeichnungen, die Ligozzi für Aldrovandi geschaffen hat, belegt auch diese Sammlung den erkenntnistheoretischen Wert der Bilder, deren Informationsgehalt allein aus Ligozzis präziser Erfassung entsteht.4
Das Krokodilblatt nimmt einen hybriden Status ein, da nicht die Konzentration auf das Tier, sondern die landschaftliche Kontextualisierung es charakterisiert. Christina Weiler meint in den Knochen im Vordergrund die ikonographische Andeutung einer Seelenwanderung zu erkennen, bei der das Krokodil eine Reinkarnation des verstorbenen Menschen darstelle.5 Eher scheint der Knochenhaufen jedoch auf das Potential des Tiers hinzuweisen, Menschen zu fressen; vergleichbare Fraßattribute finden sich auf zahlreichen Darstellungen von Raubtieren im 16. Jahrhundert.6 Die Ruinenkompartimente im Hintergrund mögen hingegen, wie Weiler schreibt, in einem gängigen ikonographischen Sinn auf das Wiederaufleben der Antike und nicht zuletzt die damit verbundene Neubewertung auch der antiken Naturkunde verweisen;7 die auffälligen Obelisken dürften allerdings auch als Verweise auf Ägypten als Verbreitungsgebiet von Krokodilen zu verstehen sein.8 Selbst im Kontext einer zoologischen Bildersammlung hat jedenfalls die Anatomie der Krokodile den Künstlern Schwierigkeiten bereitet. Auch hier deutet die übermäßige Biegung des Hinterleibs auf die gängige Verzerrung der Darstellung.
Die Naturgeschichten Gessners und Aldrovandis hatten ab dem späten 16. Jahrhundert Kompendien bereitgestellt, die über eine rein naturkundliche Erfassung der Arten hinausgingen; gerade die kulturgeschichtlichen Erweiterungen um Sprichwörter und Symbolwert speisten Material in den frühneuzeitlichen Naturdiskurs ein, das in Allegorien umgesetzt wurde.9
Exemplarisch sind die bereits erwähnten Symbola et Emblemata von Joachim Camerarius, eine vierteilige Reihe von Emblembüchern, die ausschließlich Naturmotive beinhalten. Die einzelnen Bücher sind, da sie je einhundert Embleme beinhalten, als Zenturien bezeichnet; das erste behandelt Pflanzen, die drei übrigen die Tiere der Erde, des Himmels und des Wassers. Als bestechende Leistung dieser Bücher wird heute die Exaktheit zahlreicher Pflanzendarstellungen gewürdigt; als Arzt und Botaniker war Camerarius das Studium in einem eigenen Kräutergarten möglich; überdies bezog er Informationen aus der Korrespondenz mit Gelehrten wie Aldrovandi, Francesco Calzolari und Carolus Clusius.10
Trotz dieser empirischen und um Aktualität bemühten Methoden zeigen die Symbola et Emblemata das Fortleben der mittelalterlichen Allegorese unter neuen Gesichtspunkten auf, denn der ordnende Gedanke des Werks besteht in der Suche nach dem verschlüsselten Sinn hinter der sichtbaren Erscheinung der Natur. Dieser ist jedoch nicht theologisch orientiert, sondern ethisch, denn der Körper und seine Triebe erscheinen als Herausforderung, der nur durch eine kontemplative Lebensweise zu begegnen sei.11
Camerarius versah seine Embleme mit einem kulturhistorischen Apparat, der auf den gegenüberliegen Seiten jeweils eine Auflistung von antiken und modernen Quellen als Belege liefert. In diesem philologischen Zugang zur Naturkunde liegt die Verflechtung von Deskriptivem und Sprichwörtlichem seines Emblembuchs begründet; auch Gessner und Aldrovandi hatten die antike Überlieferung als Basis ihrer naturkundlichen Schriften heran gezogen, in der Auswertung jedoch in verschiedene Sparten unterschieden, die Sprichwörter weiterführend beinhalten.12
Der Ansatz, das naturhistorische Wissen der Antike in Sinnbildern zu visualisieren und zugleich auf abstrakte Sachverhalte umzumünzen, lässt sich an einem Krokodil-Emblem der zweiten Zenturie exemplarisch nachvollziehen. Das Ikon zeigt ein Krokodil an einem Ufer vor offener See, auf der links ein Schiff fährt, rechts einige Felsen eine Insel bilden. Das Tier selbst kauert im rechten Vordergrund, in leichter Aufsicht von rechts nach links gelagert, über dem nackten Leib eines Mannes und vergießt Tränen, wobei sein Schwanz schlängelnd in die Höhe gerichtet ist. Ein zweiter, ebenfalls nackter Mensch nimmt am linken Bildrand mit erhobenen Armen Reißaus. Verstreute Muscheln kennzeichnen die Litoralzone, in der sich das Geschehen abspielt.
Unter dem Lemma „DEVORAT, ET/PLORAT“, gibt das Epigramm Aufschluss über das zu Sehende: „Non equidem ambigui dictis mihi fidere amici,/Certum est, ut lacrymis nec Crocodile tuis.“13 Das Thema des Emblems sind also wiederum die sprichwörtlichen Krokodilstränen als Zeichen falscher Freundschaft, die bereits Plinius beschrieben hatte und die über das Mittelalter durch die Physiologus-Tradition in Europa bekannt blieben, dort allerdings als Mahnung gegen Opportunismus unter Androhung von Höllenstrafen. Camerarius mag im Übrigen hervorragende Abbildungen von Pflanzen verwendet haben; seine Krokodile sind ästhetisch eher unbeholfene Phantasiegeschöpfe, deren Gestaltung hinter dem zeitgenössischen Kenntnisstand zurückblieb. Gleichwohl zeigt auch hier der flammenförmig nach oben züngelnde Schwanz, dass das Detail als Sinnbild des Hinterhältigen verstanden wurde.