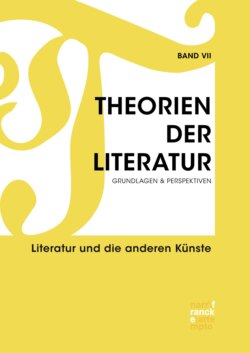Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 14
9. Merian und Seba
ОглавлениеDie Zählebigkeit, mit der sich die Schlangenschwanz-Formel hielt, wird an zwei berühmten Krokodildarstellungen des 18. Jahrhunderts deutlich. 1719 erschien die zweite, erweiterte Ausgabe von Maria Sibylla Merians Metamorphosis insectorum Surinamensium, die die Darstellung eines Kampfs zwischen einem Kaiman und einer Korallenschlange beinhaltet (Abb. 6). Die beiden Reptilien winden sich in Seitenansicht um einander; der neutral gehaltene Hintergrund und der lediglich als Fläche markierte Vordergrund gewährleisten die Konzentration auf die beiden Tiere, die mit so hoher mimetischer Präzision gestochen sind, dass die Form und Lage jeder einzelnen Schuppe nachvollziehbar wird. In einem Detail zeigt das Bild den Anlass des Kampfs, denn die Schlange ist eine Nesträuberin und lässt in ihrer Gier nicht einmal vom Ei des Kaimans ab, als dieser sie bereits mit seinen nadelspitzen Zähnen fixiert hat. Das Fortbestehen der Art bleibt ohnehin gewährleistet, denn im Schutz der Hinterbeine des Muttertiers schlüpft soeben ein Jungtier aus einem weiteren Ei. Merian hat den Kampf in geradezu ornamentalen Windungen komponiert, wobei sich insbesondere die Schlange in zwei Schleifen in die Höhe zu recken scheint. Dort wird sie von dem spiralförmig gerollten Schwanz des Kaimans gehalten; die Formen lassen den Kraftakt, in der Luft zu ringen, geradezu physisch spürbar werden.
Das Bild sticht aus seinem Kontext heraus, denn die Metamorphosis insectorum Surinamensium, in erster Auflage 1705 erschienen, waren das Ergebnis eines Aufenthalts Merians in der niederländischen Kolonie Surinam von 1701 bis 1702, wo Merian Insekten und Pflanzen studierte, Proben sammelte und Zeichnungen anfertigte. Das Buch zeigt die Ergebnisse in kolorierten Kupferstichen, die von Texten kommentiert werden. Ihr typischer Aufbau verbindet von unten ins Bild rankende Pflanzenstängel mit Blättern und Blüten sowie Insekten in verschiedenen Entwicklungsstadien zum Überblick eines je spezifischen Biotops. Nur auf einigen Tafeln fügte Merian weitere Tierarten wie Schlangen und Eidechsen hinzu, verband diese Darstellungen allerdings mit der Aussicht auf eine eigenständige Publikation zur südamerikanischen Fauna, die jedoch nicht erscheinen ist.1 Womöglich war die Darstellung des Kaimans ursprünglich dafür vorgesehen.
Ihr ging eine Zeichnung voraus, auf der Kaiman und Korallenschlange zwar in der gleichen Position kämpfen, der Anlass dazu aber unterschlagen bleibt, da das Bild nicht die Eier des Kaimans zeigt.2 Nicht nur die etwas willkürliche narrative Einbindung des Sujets für die druckgraphische Publikation legt die Vermutung nahe, dass Merian die Kampfszene kaum auf der Grundlage eigener Beobachtungen gezeichnet haben dürfte.3
Auch der Text von Merians Publikation erwähnt den Kampf nicht, sondern beschreibt den Kaiman in allgemeinen Zügen und geht kaum über jene Erkenntnisse hinaus, die bereits auf den Flugblättern des 16. Jahrhunderts über Krokodile verbreitet wurden. Dies gilt besonders für die Beschreibung des Tiers als Marodeur: Es handle sich um Krokodile, die von den Indianern „Caymans“ genannt würden, sie seien große, sehr kräftige und gefährliche Raubtiere und lebten zu Wasser wie zu Lande. Unvorstellbar sei ihr Wachstum, da sie aus kleinen Eiern schlüpften und ihre ursprüngliche Größe in kurzer Zeit um ein Vielfaches überträfen. Zweimal geht Merian auf die Schuppenpanzerung der Tiere ein: „Vorne der Oberkörper und der Schwanz sind stark geschuppt und so hart, dass sie unverletzbar sind. […] wenn sie sich mit ihren Körpern wenden und kehren könnten, würde ihnen nichts entkommen.“4
Damit widerspricht der Text deutlich den übersteigerten Windungen, in denen Merian den Kaiman zeichnete. Sie entsprechen als Fortführung der Schlangenschwanz-Tradition allerdings den gestalterischen Prinzipien von Merians Darstellungen exotischer Flora und Fauna, die, wie Susan Owens darlegte, auf Spiralformen beruhen und zur Steigerung ihrer Wirkung auch den Bildrand sprengen können.5
Merians Bild sollte für die Vorstellung von Kaimanen in Europa umso prägender bleiben, als es noch 1797 als Vorlage für eine Illustration der dritten Auflage der Encyclopædia Britannica diente. Diese zeigt schautafelhaft acht Echsen, von denen dem Kaiman im unteren Bilddrittel der meiste Raum zukommt; er ist auch als einzige Art zweifach vertreten, da ihm das schlüpfende Jungtier aus Merians Stich hinzugefügt wurde. Eine Irritation geht davon aus, dass der zuständige Kupferstecher Andrew Bell Merians Kaiman zwar recht präzise kopierte, dessen gewundene Haltung aber durch den Verzicht auf die Korallenschlange um ihren Zusammenhang brachte.
Das Rokoko-Krokodil par excellence stach jedoch Jacobus Houbraken für Albert Sebas Thesaurus, dem visuellen Kompendium zu einer der größten Naturaliensammlungen der Zeit. Noch rigoroser als bei Merian sind die Seiten dieser vier zwischen 1734 und 1765 erschienenen Bände nach dem Prinzip symmetrischer Spiralen organisiert, die insbesondere die zahlreichen Schlangen wie schleichende Rocailles aussehen lassen. Selbst ein Alligator, den Seba wie die meisten seiner Stücke direkt von den Landungsplätzen der Ost- und Westindischen Handelskompanien in Amsterdam in Empfang genommen haben mag, muss sich diesen Stilvorgaben fügen.6 In zwei gegenläufigen Windungen, den Schwanz zur Spirale gerollt, pirscht er wie eine angespannte Feder über die Bildfläche, auf eine Eidechse lauernd, die ihrerseits noch rasch den Schwanz zum heraldischen Ornament schwingt, ehe sie das Weite sucht.
Bereits 1753 veröffentlichte der Verlag der Homannschen Erben in Nürnberg eine Kopie nach Sebas Bild in einer Reihe einzelner Kupferstiche mit zoologischen Sammeldarstellungen, die den Atlanten des Verlags beigefügt werden konnten.7 Es verdichtet den gefährlichen Eindruck der Vorlage noch dadurch, dass der Bildraum durch eine Linie gerahmt ist, die das Krokodil zweifach übertritt und so als Trompe-l’oeil erscheint. Diese Augentäuschung erscheint umso vielschichtiger, als das Blatt als Bildträger durch zahlreiche Inschriften bestätigt scheint, die in Kartuschen hervorgehoben sind, aber auch in Angleichung an die Bewegung des Reptils erscheinen, so unter seiner linken Hand. Sie beinhalten nach dem Vorbild der klassischen Naturgeschichte Informationen zur Nomemklatur, zu Färbung und anderen Merkmalen sowie zum Verhalten (nicht zuletzt wird auch hier wieder auf das immense Wachstum der aus kleinen Eiern schlüpfenden Tiere hingewiesen). Allerdings deutet sich dabei eine Entzauberung der Darstellung an, denn eine Anmerkung rechts oben verrät – wohl kaum im ästhetischen Sinne Sebas –, das Krokodil sei „hier nur wegen Enge des Raums gekrümmt.“8 Die Krokodildarstellungen Merians und Sebas wurden noch bis Ende des 18. Jahrhunderts in populären Naturkunden nachgedruckt. Unter den sprunghaften Kenntnisgewinnen dieser Zeit wich jedoch die Stilisierung der Tiere einer rationaleren Darstellungsform.