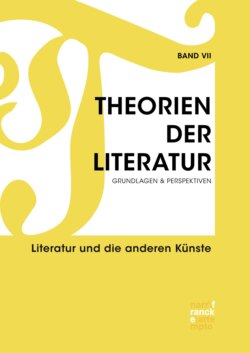Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 25
1. Vorüberlegungen
ОглавлениеZunächst zu einer kurzen Verortung des Themas im Forschungsgebiet ‚Musik und Literatur‘: Stephen Paul Scher hat in seinem einschlägigen Handbuch Literatur und Musik folgendes Schema entwickelt:1
Abb. 1: Beziehungen zwischen Musik und Literatur (Scher 1984, S. 14)
Er unterscheidet zwischen den jeweils spezifischen Perspektiven der Musik- und der Literaturwissenschaft (demnach ist die Musikwissenschaft eher für den Bereich der ‚Literatur in der Musik‘ (symphonische Dichtungen, Programmmusik) und für Bereiche zuständig, in denen ‚Musik und Literatur‘ zusammenwirken (alle Formen von Vokalmusik vom Lied bis zur Oper). Die Literaturwissenschaft ist in diesem Bereich mit im Boot; außerdem kümmert sie sich vornehmlich um alle Formen der Thematisierung von ‚Musik in der Literatur‘. Hinzu kommt übrigens das ganz große Segment des Topos des Musikalischen in der Literatur: dazu gehören die Thematisierungen von Musikerfiguren, ästhetischen Reflexionen, kulturhistorisch bedeutsamen Epochen oder Gattungen der Musikgeschichte sowie spezifische Auseinandersetzungen mit Gesang oder auch mit bestimmten Musikinstrumenten und ihrer Wirkung.2 In dieses Segment fällt auch die Frage nach der poetologischen Funktion des Kompositionsmodells ‚Symphonie‘ in der Literatur.
Die neuere musikalische Forschung fordert eine intermedialitätstheoretische Fundierung. Vorreiter war und ist hier Werner Wolf.3 Auf ihn beruft sich auch Ina O. Rajewski, die in ihrem Standardwerk zur Intermedialitätstheorie die wichtigsten Kategorien bereitstellt.4 Sie unterscheidet zwischen Intramedialität (Bezüge innerhalb eines Mediums, z.B. Intertextualität oder Gattungstraditionen), Intermedialität („Medien überschreitende Phänomene, die mindestens zwei konventionell als distinkt wahrgenommene Medien involvieren“5) und Transmedialität (medienunspezifische Phänomene wie z.B. Topoi oder ikonographische Traditionen).
Innerhalb des Bereichs Intermedialität wird noch unterschieden zwischen Medienwechsel (z.B. Literaturverfilmungen), Medienkombination (z.B. alle Arten von Textvertonungen) und Intermedialen Bezügen. Hierunter versteht Rajewski „Verfahren der Bedeutungskonstitution eines medialen Produkts durch Bezugnahme auf ein Produkt (= Einzelreferenz) oder das semiotische System (= Systemreferenz) eines konventionell als distinkt wahrgenommenen Mediums mit dem kontaktnehmendem Medium eigenen Mitteln“.6 In unserem Fall wäre dies die Bezugnahme auf das semiotische System Symphonie (im Sinne einer Systemreferenz) mit den Mitteln der poetischen Sprache. Im Einzelnen kann dies bedeuten:
eine sprachliche Reflexion über die Struktur der Symphonie
die Beurteilung ihrer ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten
eine Diskussion über ihren kulturgeschichtlichen Stellenwert
die Fokussierung/Favorisierung eines bestimmten Komponisten oder Werks
den Versuch einer strukturellen Anverwandlung von Kompositionsprinzipien
die Instrumentalisierung für eine poetologische Reflexion.
Einige Klärungen zum Begriff der Symphonie als musikalische Gattung erscheinen im Vorfeld der literaturwissenschaftlichen Betrachtung hilfreich.7 Zunächst ist festzuhalten: Wörtlich bedeutet ‚Symphonie‘ nichts anderes als ‚das Zusammenklingen‘. In der Musikgeschichte bezog sich die Bezeichnung aber von Anfang an auf Instrumentalmusik. In der frühen Neuzeit ist die Symphonie im Zusammenhang mit der Oper entstanden – in der neapolitanischen opera seria war sie als rein instrumentales Einleitungsstück konzipiert und bestand aus drei Teilen (schnell – langsam – schnell). Mit dem Aufschwung der Instrumentalmusik im 18. Jahrhundert verselbstständigte sich die Sinfonia und wurde zugleich strukturell ausgebaut bzw. mit spezifischen kompositorischen Vorgaben versehen: Dabei entwickelte sich der erste Satz zur Sonatensatzform. Nach dem zweiten langsamen Satz folgte meist ein Menuett oder Scherzo; der vierte Satz diente dann einem temperamentvollen Abschluss und der individuellen Ausdruckstiefe der Komposition. Nachdem die Symphonie schon durch die Wiener-, die Mannheimer- und die Berliner Schule etabliert worden war, prägte insbesondere Joseph Haydn mit seinen über 100 Symphonien die Erscheinungsform der klassischen Symphonie. Er ist es denn auch, dessen Kompositionskunst in der Literatur um 1800 zuallererst im Zusammenhang mit vollendeter Instrumentalmusik Erwähnung findet. Der nächste große Akteur ist bekanntermaßen Mozart, der Haydns Kompositionstechnik übernahm, aber sie an Raffinesse teilweise übertraf (so wurde es jedenfalls von den Zeitgenossen wahrgenommen). Eine eigene Tiefe und Individualität im Ausdruck verlieh schließlich Ludwig van Beethoven der Gattung. Seine Symphonien zeichnen sich aus durch „Größe und Prägnanz der Themen, Kühnheit der Harmonik, Dehnung der Form, Vitalität der rhythmischen Bildungen, Erweiterung des Orchesterapparats“ und vor allem die thematische Durcharbeitung bzw. dem Zusammenhang aller Partien.8 Die Komplexität der Beethovenschen Symphonik war es, die E.T.A. Hoffmann besonders faszinierte; in der späteren (musikwissenschaftlichen) Beethoven-Rezeption galt der Komponist dann als Vertreter einer vollendeten Klassik (von ‚Wiener Klassik‘ sprach man erst am Ende des 19. Jahrhunderts; E.T.A. Hoffmann klassifizierte Beethoven noch eindeutig als Romantiker9).
Im 19. Jahrhundert erlebte die Symphonie eine Hochkonjunktur; wobei der Bogen im deutschsprachigen Raum sich von Schubert und Schumann über Brahms und Bruckner bis zu Mahler und Richard Strauss spannt, im europäischen Kontext von Dvorak und Smetana über Tschaikowsky bis zu Berlioz und Saint-Saens. Wichtig und bemerkenswert ist, dass im 20. Jahrhundert eine durchaus ambivalente Rezeptionshaltung vorherrscht: Einige Komponisten knüpfen an die Vorbilder an (etwa: Prokofjiew, Schostakowitsch, Sibelius); andere experimentieren mit der Gattung und transformieren sie im Zeichen der modernen Musik (etwa: Reger, Hindemith, Schönberg, Webern). Nach der Jahrhundertmitte schwindet das Interesse an der Symphonie merklich.