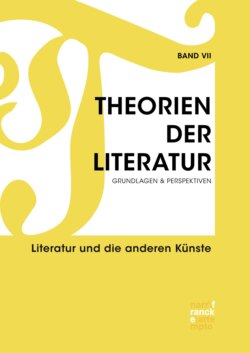Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 11
6. Präparate
ОглавлениеEinen charakteristischen Stellenwert erlangten Krokodilpräparate in den Sammlungsräumen frühneuzeitlicher Kunstkammern und Naturalienkabinette. Besonders eindrücklich zeigt etwa das 1599 veröffentlichte Frontispiz zum Sammlungsinventar des italienischen Apothekers Ferrante Imperato das Präparat eines Nilkrokodils, das rücklings von der Decke hängt, sodass sein Rückenpanzer zum zentralen Blickfang der mit zahlreichen Kuriositäten bestückten Zimmerdecke gerät (Abb. 2). Die Belebung des Interieurs mit Besuchern verleiht diesem nicht nur eine die Sammlung gleichsam aktivierende Dynamik.1 Indem der Kupferstich die von Imperatos Sohn gehaltene Führung zweier Edelmänner durch die Sammlung zeigt, offenbart er zugleich den sozialen Prestigegewinn, den bürgerliche Naturaliensammler erzielen konnten; Imperato selbst verfolgt das Geschehen in selbstgewisser Haltung an die Rückwand gelehnt, auf Augenhöhe mit dem hohen Besuch, der die Blicke, geleitet von einem Zeigestab, nach dem Krokodil richtet.
Abb. 2: Das Museum des Ferrante Imperato
Dass Krokodilpräparate zu den erstrangigen Sammlungsstücken der Kabinette zählten, belegt auch Willem Swanenburghs 1610 entstandene Darstellung des Hortus Botanicus in Leiden, der ein Vierteljahrhundert zuvor der Universität angegliedert worden war. Die in Vogelperspektive gezeigte Vedute des Gartens schließt am vorderen Bildrand mit einem separaten Streifen ab, auf dem markante Objekte der universitären Sammlung aufgereiht sind. Zu ihnen zählen drei ausgestopfte Krokodilhäute; zumindest die Schwänze der beiden kleineren Exemplare sind schlängelnd nach oben gewunden.
Die frühneuzeitlichen Naturaliensammlungen entsprachen dem Leitgedanken der Naturgeschichte, die göttliche Schöpfung gerade in ihren außergewöhnlichen Formen zu entschlüsseln. Die zentrale Hängung von Krokodilpräparaten mag dabei einerseits deren Größe geschuldet gewesen sein; in der meist symmetrischen Raumorganisation kommt Krokodilen und anderen Überformaten wie Haien und Würgeschlangen gleichwohl ein herausragender Status zu, den sie als quintessenzielle Exoten erfüllen.
Neben dieser wissenschaftlichen Präsentation konnten Krokodilpräparate jedoch auch in der Frühen Neuzeit als Drachen herhalten. Zum lokalen Wahrzeichen geriet etwa ein Krokodil, das Matthias II. 1608 der Stadt Brünn geschenkt hatte und das dort mit einer Legende in Verbindung gebracht wurde, der zufolge ein Drache einst die Stadt in Angst und Schrecken versetzt habe, dann aber durch den Witz und Mut eines Ritters überwältigt worden sei. Als ‚Brünner Drache‘ hängt bis heute ein Nilkrokodil im Durchgang des Alten Rathauses.2 Die Geschichte zeigt einerseits, dass Krokodilpräparate um 1600 zur herrschaftlichen Repräsentation gehören konnten, da sie als exotische Seltenheiten auf Finanzkraft und weitreichende Verbindungen schließen ließen; Matthias selbst soll das Krokodil von einer türkischen Delegation erhalten haben. Andererseits bietet sie eine Variante des Drachenkampfs als verbreiteter Gründungslegende, die in diesem Fall aber nicht auf die historische Christianisierung, sondern auf das städtische Selbstbewusstsein hinzuweisen scheint. Diese Affirmation des eigenen Rangs war in den Reichsstädten um 1600 verbreitet und äußerte sich maßgeblich in öffentlichen Kunstwerken, deren Ikonographie sich auf die Stadtgründungen bezieht. Auf eine annähernd gleiche Gründungssage wie Brno beruft sich etwa auch Klagenfurt, und die Kärntner Stände ließen ihrem Selbstverständnis 1590 in einer monumentalen Brunnenskulptur Ausdruck verleihen, die einen Lindwurm darstellt.3 Der Vergleich mit dem Brünner Drachen ist darin aufschlussreich, dass der Klagenfurter Lindwurm als Mischwesen aus Schlangenleib mit Pranken, Fledermausflügeln und einer Art Hundekopf kaum Merkmale eines Krokodils aufweist, sein typisch gewundener Schwanz aber eindrucksvoll auf die Bemühungen zeitgenössischer Darstellungen schließen lässt, Krokodile einer geläufigen Drachenikonographie anzugleichen.