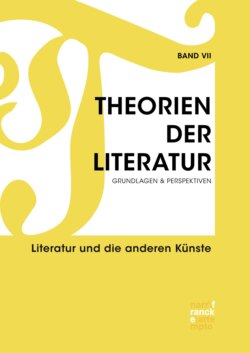Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 6
1. Visuelles Argumentationsmaterial
ОглавлениеText und Bild galten in der frühneuzeitlichen Naturkunde und insbesondere der Zoologie als gleichrangige Erkenntnismittel. Zum einen verdankte die Naturkunde des 16. und 17. Jahrhunderts einen wesentlichen Impuls der humanistischen Aufarbeitung antiker Schriften; dabei bildete etwa Plinius’ Historia Naturalis einen zentralen Bezugspunkt der nachantiken Betrachtung der Natur. Zum anderen musste sich diese Revision an den Kenntnissen exotischer Tiere messen lassen, die zunächst die spanischen und portugiesischen, dann vor allem die niederländischen Seefahrer aus Amerika und Asien nach Europa brachten. Die Basis der frühneuzeitlichen Naturkunde bestand also in der Auswertung antiker Texte; für die Einordnung bislang unbekannter Arten boten hingegen Bilder eine primäre Orientierung. Ihr epistemologischer Wert erschließt sich daraus, dass die Protagonisten der Naturgeschichte – besonders prominent Konrad Gessner und Ulisse Aldrovandi – Künstler anstellten, die nach Bildvorlagen ebenso wie lebenden Tieren und Präparaten Darstellungen von hoher mimetischer Raffinesse anfertigten. Ein berühmtes Beispiel sind zwei Vipern, die Jacopo Ligozzi, Hofkünstler der Medici, für Aldrovandi gezeichnet hat. Indem Ligozzi die Schlangen als Trompe-l’oeil darstellte – die Tiere scheinen sich, ornamental in einander verschlungen, auf dem mit zwei Textblöcken beschriebenen Blatt zu winden –, verschärfte er die Suggestionskraft der Darstellung so weit, dass die Gefährlichkeit der Giftschlangen geradezu greifbar erscheint.1
Das argumentative Potential der Bilder versuchten die Autoren auch für ihre Publikationen zu nutzen. Konrad Gessner ordnete etwa die Einträge in seiner vierbändigen, ab 1551 erschienenen Historia Animalium um die Darstellung des jeweils beschriebenen Tiers an, wobei der Text das Bild durch Verweise einbezieht. Die für den Druck benutzten Holzschnitte erreichen selten die ästhetische Qualität der Zeichnungen; gleichwohl vermögen sie wesentliche Merkmale der Tiere zu veranschaulichen. Ein berühmtes Beispiel ist die Darstellung eines Paradiesvogels im dritten Band, das zugleich die methodischen Schwierigkeiten der Erfassung exotischer Fauna aufzeigt, die jeweils nur an raren Einzelexemplaren vollzogen werden konnte. Als Vorlage scheint eine Zeichnung von Konrad Peutinger gedient zu haben, dem jedoch lediglich der Balg des Vogels vorgelegen war. Da diesem vermutlich bereits vor seinem Export nach Europa die Füße entfernt worden waren, entstand dort die Annahme, der Paradiesvogel habe keine Füße und verbringe sein gesamtes Leben im Flug.2 Sie verfestigte sich so sehr, dass der Paradiesvogel bereits in Joachim Camerarius’ ab 1592 erschienen Symbola et Emblemata zum Sinnbild für ein vergeistigtes Leben überhöht war.3
Bild und Text trugen somit gleichermaßen zu einer für die frühneuzeitliche Naturkunde bezeichnenden Ambivalenz bei: Einerseits tradierte die Rezeption der antiken Schriften auf Mythen und Legenden beruhende Informationen auch dann, wenn diese durch die eigene Anschauung falsifiziert waren, andererseits war auch die empirische Erfassung, mit der überkommene Annahmen kritisiert werden sollten, kaum gegen Fehldeutungen gefeit, da gerade im Falle exotischer Fauna oft nur einzelne Exemplare untersucht und keine überindividuellen Merkmale festgestellt werden konnten. Im Folgenden soll an einer Motivgeschichte des Krokodils vom 15. bis ins 18. Jahrhundert dargelegt werden, wie sich bestimmte Stereotype in der Darstellung der Tiere etablierten und tradiert wurden, und damit die frühneuzeitliche Ikonographie des Krokodils umrissen werden. Die These lautet, dass die Übernahme bestimmter Formeln aus dem Bereich der Hochkunst die naturhistorischen Illustrationen selbst dann noch stilisierte, wenn die Augenzeugenschaft der Autoren die entsprechenden Eindrücke bereits falsifizieren konnte.