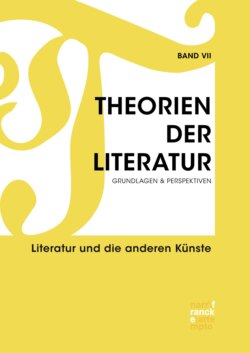Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 12
7. Ikonographie der Erdteile
ОглавлениеDen Status des paradigmatischen Exoten, den Krokodile im Sammlungsgefüge von Kunstkammern und Naturalienkabinetten einnahmen, bestätigt auch ihr Einsatz in der Ikonographie der Erdteile. Die Darstellung der vier Kontinente Europa, Asien, Afrika und Amerika als Personifikationen mit charakteristischen Attributen aus Kultur und Natur gehört zu den verbreitetsten Themen frühneuzeitlicher Bildprogramme. Ihre definitive Anweisung formulierte Cesare Ripa in der zweiten Ausgabe seiner Iconologia von 1603, in der er zugleich die eigentliche Bedeutung des Zyklus als Bekräftigung der europäischen Vorrangstellung in der Welt umriss. Demnach solle Europa als Trägerin der einzig wahren Religion mit imperialen Zügen hervorgehoben werden. Ihr und der annähernd gleichwertigen Erscheinung Asiens stehen als unzivilisierte Erdteile Afrika und Amerika gegenüber, die Ripa vornehmlich anhand wilder und gefährlicher Tiere bestimmt. Ripa orientierte sich für seine Entwürfe an antiken Text- und Bildquellen, auf die auch die Personifikation von Ländern bzw. Erdteilen als weibliche Figuren zurückgeht; für die Charakterisierung Amerikas berief er sich auf die Reiseliteratur seit Kolumbus und Vespucci.
Ihr entnahm er auch das für die amerikanischen Indigenen lange Zeit bemühte Stereotyp der Anthropophagie, das auf die vermeintliche Beobachtung von Menschenfleisch in den Vorräten brasilianischer Tupi durch Vespucci zurückging und in Reiseberichten des 16. Jahrhunderts auf grausame Weise bestätigt schien. Ripa schildert die Personifikation Amerikas dementsprechend als menschenfressende Amazone, deren Streitbarkeit durch ihre Bewaffnung mit Pfeil und Bogen und deren Anthropophagie durch einen pfeildurchbohrten Menschenkopf zu ihren Füßen zu verbildlichen sei. Als Begleittier weist er ihr ein Krokodil zu, das nicht nur für die gefahrvolle Fauna Amerikas stehe, sondern als Menschenfresser der Anthropophagie der Personifikation entspreche: „La lucerta, overo liguro sono animali fra gli altri molto notabili in quei paesi, peri òche sono grandi, &fieri, che devorano non solo li altri animali: ma gl’huomini ancora.“1
Abb. 3: Ein Nilkrokodil als Attributtier der Personifikation Afrikas
Noch schärfer als Ripa hatte der niederländische Kupferstecher Adriaen Collaert bereits 1589 ein Krokodil als Alteritätszeichen eingesetzt. In einer Serie von Erdteil-Allegorien nach Entwürfen von Maerten de Vos ordnete er es allerdings nicht Amerika, sondern Afrika als Begleittier zu (Abb. 3). Der muskulöse Akt der Personifikation reitet auf dem von rechts nach links durchs Bild stolzierenden Reptil, das die umgebende Natur geradezu subsumiert. Diese besteht aus einer schroffen Weltlandschaft voll wilder Fauna, im Hintergrund einerseits durch Palmen als exotisch markiert, andererseits durch einen Obelisken und ein Aquädukt auf die Bedeutung Nordafrikas in der Antike verweisend. Die paradigmatische Erscheinung des Krokodils wird links durch die Gegenüberstellung seines Mauls mit dem eines (phantastisch gestalteten) Nilpferds betont, rechts durch die Parallelisierung seines schleifenförmig gewundenen Schwanzes mit einem verschlungenen Schlangenpaar; diese Form wird im linken Mittelgrund überdies in der Figur eines Basilisken aufgenommen, der auf die in der antiken Literatur beschriebenen Wundertiere des afrikanischen Hinterlands verweist und als vermeintlich todbringendes Geschöpf ein besonderes Faszinosum der frühneuzeitlichen Naturkunde bildete.
Das Motiv einer Krokodilreiterin mag bizarr erscheinen, doch dürfte es von einer Plinius-Passage motiviert gewesen sein, der zufolge ein legendäres Volk in Afrika einst Krokodile soweit zu zähmen verstanden hätte, dass es sie als Reittiere nutzen konnte. Collaert gelang durch diese Darstellung jedenfalls die Suggestion beinahe magisch mit der Natur verbundener Ethnien, die einen umso größeren Gegensatz zu den europäischen Kulturgesellschaften bilden, als die von ihnen harmonisierte Fauna als heimtückisch und giftig dargestellt wird.