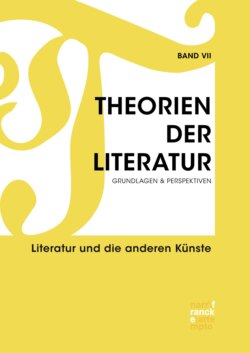Читать книгу Theorien der Literatur VII - Группа авторов - Страница 9
4. Kunsttheorie und Ikonographie
ОглавлениеDieses Bilddetail kann als Pathosformel der Drachendarstellung gelten. Mehrfach gewundene oder gerollte Schwänze sind bereits auf Tierdarstellungen antiker Sarkophage zu sehen; lückenlos zieren sie dann die Darstellung von Drachen, Basilisken und Meeresungeheuern bis weit in die Frühe Neuzeit. Als prominente Beispiele seien nur der Drache auf Paolo Uccellos Darstellung des Heiligen Georg von 1470 oder jener auf Raffaels Heiliger Margarete erwähnt. In der Bildpraxis, Drachen als Mischwesen aus Merkmalen verschiedener, potentiell für den Menschen gefährlicher Tiere zu gestalten, verweist der Schlangenschwanz nicht nur auf die in der Genesis begründete negative Assoziation der Schlange.1 Insbesondere in der Spätrenaissance, als sich gewundene Bewegungen als stilistisches Prinzip etablierten, geriet die Schlangenform, die Figura serpentinata, in den Fokus der Kunsttheorie. Bereits Leonardo da Vinci hat in seinen Tierstudien über diese Windungen als ein motorisches Prinzip der Tierwelt nachgedacht; auf einem Studienblatt, das mehrere Federskizzen von Drachenkämpfen zeigt, notierte er: „Die schlangenartige Bewegung ist die vorrangigste Bewegung bei Tieren und ist zweifach, denn die erste erfolgt längs, die zweite der Quere nach.“2 Und 1584 empfahl Giovanni Paolo Lomazzo bekanntlich die Schlangenwindung in seinem Trattatto dell’arte della pittura als eine Grundlage des Gestaltideals, wofür er als Zeugen immerhin Michelangelo aufrief; für Lomazzo war die Anwendung der Schlangenlinie nichts weniger als „das ganze Geheimnis der Malerei.“3
War die formale Betonung der Schlangenbewegung im 16. Jahrhundert also von der Kunsttheorie verbürgt, erklären Quellen der selben Zeit auch den besonderen Gehalt des Schlangenschwanzes als Symbol für List und Tücke. So zeigt eine Allegorie des Irrglaubens von Antonius Eisenhoit die personifizierte Häresie als schöngewachsenen Frauenakt, der jedoch mit Hirschhufen und Eselsohren sowie den Köpfen eines Drachens und eines Stiers zum Mischwesen mutiert. Neben Bibel, Rosenkranz und Geldbeutel ist ihr ein Mantichor als Begleittier zur Seite gestellt. Von besonderem Interesse ist jedoch der lange Schlangenschwanz, der der Häresie aus dem Steißbein wächst und, zu zwei Rollen gewunden, im rechten Vordergrund in Form einer Pfeilspitze ausläuft. Eine Beischrift erläutert die Bedeutung der einzelnen Motive. Drachenkopf und Stierkopf stünden demnach für Irrlehre und Wildheit, Bibel und Rosenkranz für den erlogenen Gottesnamen und Scheinheiligkeit, der Geldbeutel für Gier. Der Schlangenschwanz schließlich verdeutliche Hinterhalt: „Cauda serpent insidias.“4
Der gerollte Krokodilschwanz auf dem Straßburger Flugblatt mag nur ein Beispiel für die Verzerrung naturkundlichen Wissens auf der populären Ebene des 16. Jahrhunderts sein; tatsächlich folgte auf ihn eine in Antwerpen angefertigte Kopie, auf der das Krokodil jedoch aus einem Gewässer steigt, sodass der Schwanz nicht zu sehen ist. Damit ist nicht nur die offenbar auch von Zeitgenossen für unwahrscheinlich befundene Darstellung eliminiert, sondern zugleich auf die amphibische Lebensweise von Krokodilen hingewiesen. Der Text auf dem Antwerpener Flugblatt beinhaltet denn auch nicht die Geschichte des Drachentöters, sondern eine niederländische Übersetzung des entsprechenden Abschnitts aus Münsters Cosmographia.5 Doch obwohl dieses Flugblatt belegt, dass im 16. Jahrhundert durchaus an der Darstellung von Krokodilen mit gerollten und gewundenen Schwänzen gezweifelt wurde, hielt diese sich, konsolidiert von Kunsttheorie und Symboldenken, mit erstaunlicher Beharrlichkeit.