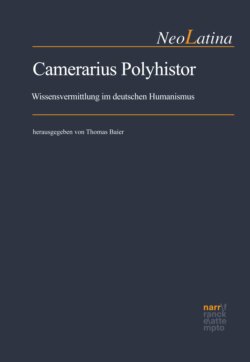Читать книгу Camerarius Polyhistor - Группа авторов - Страница 7
Die Ausgangslage: Stand der Forschung und Erschließung
ОглавлениеUngeachtet seiner Wertschätzung als „hervorragendster deutscher Philologe des 16. Jahrhunderts“ nach ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius von Rotterdam1Stählin, Friedrich hat Joachim Camerarius d.Ä. in der Forschung nicht die entsprechende Aufmerksamkeit gefunden. Eine aus den Quellen gearbeitete Gesamtdarstellung seiner Vita, die über die Leichenrede seines Leipziger Kollegen FreyhubFreyhub, Andreas (1574) und über die neueren (Kurz)biographien2 hinausginge, fehlt bis heute.3 Ähnlich lückenhaft ist der Forschungsstand zu seinem Œuvre, das sich auf über 880 Drucke (bis zum Jahr 1700, mit Neuausgaben) in lateinischer bzw. griechischer Sprache verteilt und durch seine Vielfalt beeindruckt: Camerarius besorgte Editionen und Kommentierungen vor allem antiker Autoren, er übersetzte aus dem Griechischen und Deutschen ins Lateinische, er schrieb Lehrbücher für den Sprach- und Rhetorikunterricht sowie pädagogische Abhandlungen, verfasste ein breites Spektrum an griechischen und lateinischen Dichtungen und ist Autor naturkundlicher, theologischer (insbesondere katechetischer), (kirchen-)historischer und biographischer Schriften. Als Beiträger ist er an zahlreichen Publikationen Dritter beteiligt, zudem ist von ihm ein großes, nur teilweise gedrucktes Briefcorpus erhalten.
Obwohl die Forschung seit jeher die Bedeutung des Camerarius als Philologe, als Polyhistor sowie als Schul- und Universitätsreformer4 erkannt hat, setzt sie sich mit seinem Gesamtwerk bisher nur selektiv auseinander.5 So liegen zu seiner Tätigkeit als Herausgeber, Kommentator und Übersetzer mehrere Einzelstudien, aber keine umfassende Darstellung vor: Beachtung gefunden haben u.a. die PlautusPlautus-Editionen,6 seine DürerDürer, Albrecht-Schriften und -Übersetzungen7 oder der SophoklesSophokles-Kommentar,8 daneben auch die vielfach aufgelegte Sammlung der Fabulae AesopAesopicae,9 die Interpretationen zu HomerHomer,10 die lexikalisch-terminologischen Hilfsmittel11 oder die Lehrbücher zur griechischen und lateinischen Sprache12. Aus der Vielzahl an Dichtungen hat das kleine Corpus der Eklogen eine überproportionale Aufmerksamkeit erfahren.13 Von weiteren Einzelstudien (etwa zu den NoricaCamerarius d.Ä., JoachimNorica sive de ostentis)14 abgesehen, ist der Großteil der Werke kaum ansatzweise untersucht. Ein Gesamtprofil zeichnet sich nur umrisshaft ab.
Vor diesem Horizont hat die neuere Forschung versucht, das unwegsame Terrain zu vermessen und Wege zu seiner Erschließung aufzuzeigen. Nach der Pionierarbeit von Frank Baron, dessen Sammelband wesentliche Impulse setzte,15 haben Rainer Kößling und Günther Wartenberg mit der Leipziger Tagung im Jubiläumsjahr 2000 die aktuelle Forschung gebündelt und neue Perspektiven eröffnet.16 Jüngste Publikationen gelten der Stellung des Camerarius in der Leipziger Universitätsgeschichte;17 neuere Lexikonartikel fassen den Forschungsstand zusammen und benennen Desiderate.18 Den Blick auf Camerarius’ Werkvielfalt jenseits der bekannten ‚Meilensteine‘ richtete schließlich die Würzburger Tagung „Camerarius Polyhistor“, welche 2015 die internationale Camerarius-Forschung zusammengeführt hat.
Trotz dieser intensivierten Bemühungen steht die Forschung weiterhin vor pragmatischen Schwierigkeiten: Sie sieht sich mit einem außergewöhnlich umfänglichen, thematisch vielfältigen und sprachlich nicht leicht zugänglichen Œuvre konfrontiert, und es mangelt an grundlegenden heuristischen Vorarbeiten.
Die editorische Erschließung der Camerarius-Schriften ist rudimentär. Neben einzelnen Faksimilia19 und Teilveröffentlichungen20 liegen neuere Ausgaben lediglich zu den drei großen Biographien,21 zu den Eklogen,22 zur Geschichte der Böhmischen Brüder23 und zu einem kleinen Teil des Briefwechsels24 vor. Zumindest sind dank der jüngsten Digitalisierungsprojekte inzwischen gut 90 % der relevanten Drucke als Scans verfügbar. Am schwersten aber wiegt, dass bis heute kein vollständiges Schriftenverzeichnis von Joachim Camerarius existiert, obwohl man sich schon früh um ein solches bemüht hat.25 Auf der Grundlage eines avitorum scriptorum catalogus aus dem Besitz der Camerarii hatte Georg SummerSummer, Georg 1646 eine chronologische Übersicht über die Werke des Joachim Camerarius publiziert.26Summer, Georg Sie wurde von Johann Albert FabriciusFabricius, Johann Albert für die Bibliotheca Graeca ausgewertet, korrigiert und ergänzt,27 und dieses Verzeichnis wurde seinerseits durch August Wilhelm ErnestiErnesti, August Wilhelm (Leipzig 1782/86) fortgeführt.28Ernesti, August Wilhelm Im 20. Jahrhundert kamen mit dem Index Aureliensis und Frank Barons Liste der Erstdrucke zwei Schriftenverzeichnisse hinzu.29 Gegenüber diesen Aufstellungen, die v.a. bibliographische Daten aus zweiter Hand kompilieren, bietet das alphabetische Corpus der Camerarius-Drucke im VD16 einen breiteren Überblick,30 ist aber ebenfalls weder fehlerfrei noch vollständig.
Demgegenüber übertreffen die Online-Versionen von VD16 und VD17 (http://www.vd16.de und http://www.vd17.de) alle vorgängigen Bibliographien an Umfang. Aktuell sind dort insgesamt 863 Drucke verzeichnet, an denen Joachim Camerarius d.Ä. als Verfasser, Beiträger oder Bearbeiter beteiligt war. Allerdings beschränken sich VD16/17 auf Drucke aus dem deutschen Sprachbereich und verweisen nur auf Digitalisate deutschsprachiger Bibliotheken. Es wird zwar die Art von Camerarius’ Beteiligung an den Drucken genannt, aber nicht, worin seine Beiträgerschaft genau besteht. Wie viele und welche Werke Camerarius verfasst hat, lässt sich bisher also nur annäherungsweise feststellen.