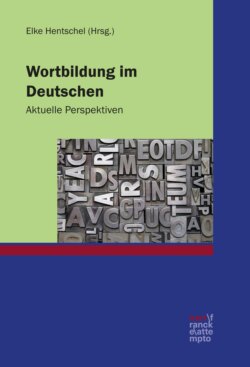Читать книгу Wortbildung im Deutschen - Группа авторов - Страница 40
1 Einleitung
ОглавлениеMit dem Einsetzen der schriftlichen Überlieferung des DeutschenDeutsch im frühen Mittelalter beginnt auch die Entwicklung einer deutschen Schriftsprache. Zwar bleibt noch für lange Zeit die Dominanz des seit der Antike im westlichen Europa als Schriftsprache vorherrschenden Lateinisch ungebrochen und so ist auch die Entwicklung der deutschen Schriftsprache nur in ihrer Abhängigkeit von und in ihren Wechselbeziehungen mit dem Lateinischen zu sehen, doch beginnt hier schon die Entwicklung des Deutschen hin zu einer Schrift- und Literatursprache, die in allen Bereichen der schriftlichen Kommunikation Anwendung finden und schließlich das Lateinische ablösen kann.
Mit dieser Entwicklung ist eine Ausdifferenzierung der Sprache verbunden, die sich vor allem im Wortschatz zeigt, denn es müssen neue Bezeichnungen für Konzepte gefunden werden, die dem DeutschenDeutsch bislang ‚fremd‘ waren, da für sie im Rahmen der mündlichen Alltagskommunikation keine Bezeichnungsnotwendigkeit bestand. Hierbei kommen neben Wortentlehnungen und Lehnbedeutungen vor allem Lehnbildungen, also die Verfahren der WortbildungWortbildung (DerivationDerivation und KompositionKomposition) zum Tragen (cf. Meineke 2007: 232).
Diese Ausdifferenzierung des Wortschatzes wird auch notwendig, da die situationsenthobene schriftliche Kommunikation größere Exaktheit verlangt als die im Alltagskontext situationsgebundene mündliche Kommunikation (Solms 1999: 241). Dementsprechend nimmt auch der Anteil der Substantivkomposita, die als Determinativkomposita eine enger bestimmte, exaktere ReferenzReferenz ermöglichen, am Gesamt des Substantivwortschatzes vom Mittelalter bis zur Gegenwartssprache deutlich zu (Solms 1999: 234).
Angesichts dieser Überlegungen mag es verwundern, dass es nach wie vor kaum umfassendere Untersuchungen gibt, die sich der KompositionKomposition im AlthochdeutschenAlthochdeutsch widmen (cf. Meineke 2007: 233) und insbesondere solche Untersuchungen, die sich über die systemlinguistische Darstellung der Komposition als eines Wortbildungsverfahrens hinaus der Frage widmen, welche Rolle diese bei dem oben beschriebenen Prozess der Ausdifferenzierung der deutschen Sprache spielt.
So zeigt etwa Erben (1987), wie KompositaKompositum in den althochdeutschen Texten „Christus und die Samariterin“ und Otfrids „Evangelienbuch“ verwendet werden, um etwas Neues (insbesondere die christliche Botschaft) auszudrücken. Mit dem Einfluss des Lateinischen auf das Althochdeutsche und hier insbesondere auf den neuen, christlichen Wortschatz, beschäftigt sich auch Betz (1936) für den Abrogans und Betz (1949) für die althochdeutsche Benediktinerregel. In seiner zusammenfassenden Übersicht zu Forschungen zu „LehnwörterLehnwort[n] und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen“ stellt Betz (1974: 143) zwar fest, dass die neuen christlichen Begriffe im Abrogans und der Benediktinerregel ganz überwiegend durch Lehnbedeutungen wiedergegeben werden, gleichzeitig schätzt er den Anteil von Lehnbildungen am althochdeutschen Gesamtwortschatz aber auf immerhin 10 % (Betz 1974: 145).
In der Folge von Betz beschäftigen sich verschiedene Dissertationen mit dem Lehngut und insbesondere auch mit Lehnbildungen bei NotkerNotker III. von St. Gallen: Schwarz (1957), Mehring (1958) sowie Coleman (1963, Zusammenfassung: 1964). Für den religiösen Wortschatz der Psalter-Bearbeitung stellt Betz (1974: 151) aufbauend auf Schwarz (1957) wieder eine deutliche Dominanz der Lehnbedeutungen mit fast 80 % fest, aber auch die Lehnbildungen spielen wieder eine gewisse Rolle (10 % des religiösen Wortschatzes sind LehnübersetzungenLehnübersetzung, 7 % Lehnübertragungen).
Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man Notkers Bearbeitung des Martianus Capella betrachtet, wobei bei diesem nicht-christlichen Text die Lehnprägungen in allen Sachgruppen betrachtet werden. Hier stellt Betz (1974: 152) ausgehend von Mehring (1958) eine Dominanz der Lehnbildungen fest: über die Hälfte der Lehnprägungen (also des Lehnguts ausgenommen der LehnwörterLehnwort) sind LehnübersetzungenLehnübersetzung, fast ein Drittel sind Lehnübertragungen, immerhin 12 % Lehnschöpfungen und nur 6,6 % Lehnbedeutungen.
Coleman (1963) untersucht die Lehnbildungen in Notkers Consolatio-Bearbeitung und gibt in der Zusammenfassung ihrer Dissertation (Coleman 1964) dann basierend auch auf den anderen o.g. Arbeiten einen Überblick über die Lehnbildungen bei NotkerNotker III. von St. Gallen. Sie stellt fest, dass von den Lehnbildungen Notkers noch ca. 40 % im Mittelhochdeutschen weiterleben, wobei dies im Einzelnen für 48 % der LehnübersetzungenLehnübersetzung, ein Drittel der Lehnübertragungen und 28 % der Lehnschöpfungen gilt. Es zeigt sich hier, dass ein großer Teil der von Notker neu gebildeten Lehnbildungen nicht im Wortschatz bleiben. Die größte „Überlebenschance“ haben noch Lehnübersetzungen, dies gilt auch generell für Lehnbildungen im AlthochdeutschenAlthochdeutsch (cf. Betz 1974: 152, passim).
Dies könnte laut Betz (1974: 152) daran liegen, dass die Autorität des Lateinischen bei der genaueren Nachbildung in der LehnübersetzungLehnübersetzung stärker fortwirkt als etwa in der Lehnübertragung oder gar Lehnschöpfung. Als weiteren Grund kann man noch annehmen, dass die Lehnbildungen Notkers zu einem großen Teil ad hoc gebildet wurden und gar nicht in den Wortschatz aufgenommen wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann später das gleiche Wort als Übersetzung desselben lateinischen Lemmas noch einmal gebildet wird, ist bei der Lehnübersetzung natürlich größer als bei den anderen Lehnbildungen. Auch Betz (1974) weist darauf hin, dass es sich bei der entstehenden deutschen Literatursprache noch um ein „Schreibstubenerzeugnis“ handelt, und dass „das Meiste von dieser allerersten und oft noch sehr gewaltsamen Formung durch das Latein, […] nur ein einmaliges sprachliches Experiment“ war (Betz 1974: 149) und „vielfach noch mehr aus augenblicklicher Übersetzungsnot für den Augenblick geschaffen“ wurde (Betz 1974: 150).
So sieht auch Glauch (1993) die Substantivkomposita in Notkers Texten als nichtlexikalisierte Gelegenheitsbildungen (Glauch 1993: 134). Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Untersuchungen zum Lehnwortschatz bei NotkerNotker III. von St. Gallen argumentiert Glauch (1993: 127), dass ein großer Teil der Substantivkomposita in Notkers Texten zwar in Abhängigkeit von der lateinischen Vorlage gebildet wurde, aber nur mit Einschränkung zum Lehnwortschatz gezählt werden könne. Sie sieht die Substantivkomposita bei Notker nicht als Lexeme an sondern vielmehr als „akzidentiell zur Worteinheit geronnene Phrasen“ (Glauch 1993: 132), die sich nicht von anderen, syntaktischen Ausdrucksmöglichkeiten unterscheiden und sie erkennt in der KompositionKomposition ein produktives Mittel zum Ausdruck von Attributen, dem bei Notker oft der Vorzug gegenüber einer syntaktischen Übersetzung gegeben wird (Glauch 1993: 133).
In Bezug auf die Frage, welche kommunikative Funktion die Substantivkomposita im Kontext der Klosterkultur und Klosterschule spielen können, ist hier noch vor allem die Dissertation von Delphine Pasques (2003b) zu nennen, die neben einer formalen (prosodischen und graphematischen) und semantischen Darstellung der Substantivkomposita in Notkers Psalter auch eine Darstellung unter pragmatischen Gesichtspunkten enthält, wo sie die KompositaKompositum unter dem Aspekt der argumentativen Strategien der mittelalterlichen Verfasser (NotkerNotker III. von St. Gallen und Notkerglossator) darstellt. Diesen Ansatz verfolgt Pasques (2003a) auch in einem Aufsatz, wo sie ausgehend von Karl Bühlers Organon-Modell die Substantivkomposita in Notkers Psalter in Bezug auf ihre kommunikative Funktion hin untersucht.
Bei Pasques (2003b, 2003a) findet sich also schon ein interessanter Ansatz für eine Betrachtung der Substantivkomposita aus kulturanalytischer Perspektive, wenn sie nämlich nach der kommunikativen Funktion und nicht nach morphologischen Eigenschaften fragt. An dieser Stelle soll auch mein hier vorgestelltes Dissertationsprojekt ansetzen, wenn der Frage nachgegangen wird, wie NotkerNotker III. von St. Gallen1Notker III. von St. Gallen bei seiner didaktischen Bearbeitung und Übersetzung2 von Schultexten bestimmte WortbildungsmusterWortbildungsmuster operationalisiert, um bestimmte Inhalte zu vermitteln. Es soll also gezeigt werden, wie der Lehrer und Übersetzer Notker das diesen Wortbildungsmustern innewohnende Sinngebungspotential kreativ nutzt, wo er Begriffe aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, für die es bisher noch keine Bezeichnungen in dieser Sprache gab. Die SubstantivkompositionSubstantivkomposition soll hier also als eine mögliche sprachliche Strategie betrachtet werden, die dem frühmittelalterlichen Übersetzer zur Verfügung steht, wenn er sich vor die oben beschriebene Herausforderung gestellt sieht.3KompositionWortbildungMetapher