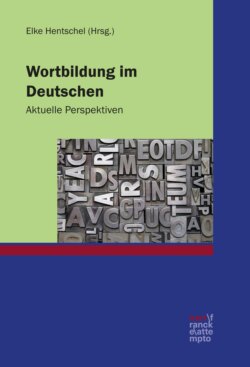Читать книгу Wortbildung im Deutschen - Группа авторов - Страница 41
Оглавление2 Materialgrundlage und Untersuchungsgegenstand
2.1 Das Korpus: Notkers althochdeutsches Übersetzungswerk
Als Materialgrundlage der vorgestellten Untersuchung dient wie erwähnt das althochdeutsche ‚Übersetzungswerk‘ Notkers, wobei das Korpus sämtliche seiner überlieferten Schriften umfasst, die deutsches Sprachmaterial enthalten. Als Textgrundlage dient die Edition von King/Tax (NotkerNotker III. von St. Gallen der Deutsche 1972–2009).
NotkerNotker III. von St. Gallen dürfte um 950 im Thurgau geboren sein und er starb am 28. Juni 1022 im Kloster St. Gallen. Dort war er Mönch und Schulvorsteher (caput scholae) und in späteren Jahren auch Leiter der Bibliothek. Als Lehrer übersetzte Notker eine Reihe von Schultexten aus dem Lateinischen ins Deutsche, um seinen Schülern das Verständnis dieser Texte zu erleichtern, denn wie er selbst in seinem Brief an Bischof Hugo II. von Sitten sagt, sei es viel leichter etwas in der eigenen Muttersprache, der „patria lingua“, zu verstehen als in einer Fremdsprache, einer „lingua non propria“:
Ad quos dum accessvm habere nostros uellem scolasticos aus<us s>vm facere rem pene inusitatam . ut latine scripta in nostram linguam conatus sim uertere […] (Nep 348,9f.)1Notker III. von St. Gallen
(Da ich wünschte, dass unsere Schüler zu diesen [den Sieben Freien Künsten] Zugang haben, wagte ich es, eine beinahe unerhörte Sache zu tun, dass ich es nämlich unternahm lateinische Schriften in unsere Sprache zu übersetzen […]. [Üs. NJR])
[…] quam [s]cito capiuntur per patriam linguam . quę aut uix aut non integre capienda forent in lingua non propria (Nep 349,24f.)
([…], weil man in der Muttersprache schneller versteht, was man in einer fremden Sprache entweder kaum oder nicht vollständig verstehen würde. [Üs. NJR])
Seit der Spätantike und Cassiodor bestand der schulische Lehrinhalt aus den Sieben Freien Künsten und im frühmittelalterlichen Europa waren Klöster und Klosterschulen die Zentren von Bildung und Gelehrsamkeit. Spätestens seit dem 9. Jahrhundert bildet sich ein Kanon von Schultexten heraus, die im Unterricht an den Klosterschulen verwendet wurden (cf. Glauche 1970). Die meisten von Notkers Übersetzungen sind solche kanonischen mittelalterlichen Schultexte aus allen Bereichen der Sieben Freien Künste und sie entstanden in engem Zusammenhang mit der Tätigkeit Notkers als Lehrer und also mit der WissensvermittlungWissensvermittlung in der frühmittelalterlichen Klosterschule in St. Gallen.
Über die Schultexte hinaus bearbeitete NotkerNotker III. von St. Gallen aber auch theologische Texte wie etwa den Psalter, die nicht zum Schulkanon gehören sondern eher in den Bereich frühmittelalterlicher Wissenschaft (also der Theologie). Aber auch bei diesem Text, den Henkel (1988: 75–76) als Erbauungsliteratur einordnet, lässt sich ein didaktischer Anspruch des Verfassers erkennen, der auch hier Erklärungen und Kommentare in seine Bearbeitung einarbeitet.
Notkers Übersetzungen sind nämlich keine bloßen Übersetzungen sondern vielmehr didaktische Bearbeitungen für den Schulunterricht, die auf das Verständnis des Originaltextes ausgerichtet sind. In seinen Texten kombiniert er den Text des lateinischen Originals (in syntaktisch vereinfachter Form) mit seiner Übersetzung und Kommentaren, die er aus antiken und frühmittelalterlichen Autoritäten schöpft, wobei die für NotkerNotker III. von St. Gallen typische sogenannte deutsch-lateinische Mischsprache entsteht (cf. Sonderegger 1970: 87–90; Henkel 1988: 77–86).
2.2 Untersuchungsgegenstand: Substantivkomposita
Diese im Schulkontext entstandenen Texte dienen also als Korpusgrundlage für die vorgestellte Untersuchung, in der die SubstantivkompositionSubstantivkomposition als eine sprachliche Strategie betrachtet werden soll, die nutzbar gemacht werden kann, wo neue Wissensinhalte und somit neue Begriffe vermittelt werden sollen. Der konkrete sprachliche Untersuchungsgegenstand sind also die Substantivkomposita.
Der Normaltyp der Substantivkomposita im DeutschenDeutsch sind die Determinativkomposita (Ortner/Ortner 1984: 11) und im NotkerNotker III. von St. Gallen-Korpus sind diese auch der einzige Typ, der begegnet.1 Determinative Substantivkomposita werden durch die Kombination zweier existierender, frei vorkommender Lexeme gebildet, von denen das zweite ein Substantiv sein muss, so dass auch das WortbildungsproduktWortbildungsprodukt ein Substantiv ist. Das Zweitglied (B-Konstituente) ist der Kopf der Bildung und wird durch das Erstglied (A-Konstituente) näher bestimmt.
Zur Abgrenzung von anderen komplexen Wörtern referieren Ortner/Ortner (1984: 11–39) insgesamt 16 Eigenschaften von KompositaKompositum, die in der Literatur genannt werden. Neun dieser Eigenschaften betreffen das KompositumZusammensetzung (siehe auch Kompositum) als Ganzes (Ortner/Ortner 1984: 12–28), fünf sind Eigenschaften einzelner Konstituenten (Ortner/Ortner 1984: 28–38) und zwei Eigenschaften kommen dem Kompositum als Textelement zu (Ortner/Ortner 1984: 38–39). Meineke (1991) bespricht die Kriterien von Ortner/Ortner (1984) und hierarchisiert sie. Zuoberst ordnet er die Eigenschaften an, die dem Kompositum als Ganzem zukommen. Lediglich vier der dort genannten neun Kriterien sieht er als uneingeschränkt gültig an (primäre Kriterien), alle anderen Kriterien sieht er als sekundäre oder tertiäre Kriterien oder verwirft sie ganz (Meineke 1991: 73–76, passim). Diese vier zentralen Eigenschaften von Komposita sind die Binarität, die Subordination der Konstituenten, die allgemeine Strukturbedeutung (in Verbindung mit der nichtexpliziten Konstruktionsbedeutung) und die Kompatibilität der Konstituenten in sachlogischer Hinsicht. Auf diese vier Kriterien soll im Folgenden kurz eingegangen werden, wobei zunächst die beiden für die vorgestellte Untersuchung wichtigsten Eigenschaften vorgestellt werden sollen (s.u. Abschnitt 3.1).
Das Kriterium der Binarität besagt, dass jedes Substantivkompositum sowohl morphologisch als auch semantisch binär strukturiert ist (Ortner/Ortner 1984: 16–17; Meineke 1991: 38–45). Die Zweigliedrigkeit von KompositaKompositum ist laut Meineke (1991: 39) die Folge einer Determinans-Determinatum-Struktur, die wiederum die Widerspiegelung einer menschlichen Denkstruktur ist, die Meineke (1991: 39) mit „[e]twas wird durch ein anderes näher bestimmt“ angibt. Der Ausgangspunkt eines jeden KompositumsZusammensetzung (siehe auch Kompositum) sei demnach seine Funktion, ein binäres Konzept zu bezeichnen. Eine Funktion, für die einzelsprachlich verschiedene Mittel zur Verfügung stehen, neben der KompositionKomposition etwa Konstruktionen mit Genitiv- oder Adjektivattributen oder Präpositionalphrasen.
Die zweite für diese Untersuchung zentrale primäre Eigenschaft von KompositaKompositum nach Meineke (1991: 51–55) ist die nichtexplizite Konstruktionsbedeutung.2 Das heißt, dass die semantische Relation zwischen den Konstituenten eines KompositumsZusammensetzung (siehe auch Kompositum) auf morphologischer Ebene nicht ausgedrückt wird. Die Konstruktionsbedeutung eines Kompositums (also die jeweils im Einzelfall existierende semantische Relation zwischen den Konstituenten)3 lässt sich zurückführen auf eine allgemeine Strukturbedeutung von Komposita: „B, das mit A zu tun hat“ (Meineke 1991: 73). Die allgemeine Strukturbedeutung in Verbindung mit der Tatsache, dass die Konstruktionsbedeutung in Komposita nicht expliziert wird, hat zur Folge, „daß das Kompositum als wortbildungstechnisches Universalwerkzeug einsetzbar ist“ (Meineke 1991: 73).
Die beiden verbleibenden primären Kriterien besagen, dass das, was im KompositumZusammensetzung (siehe auch Kompositum)Kompositum zusammengebracht werden soll, außersprachlich kompatibel sein muss („sachlogische Kompatibilität der Konstituenten“, Meineke 1991: 68–71), und dass die Reihenfolge der Konstituenten im Kompositum auf Determinans vor Determinatum festgelegt ist, was das semantische Funktionieren des Wortbildungsprodukts gewährleistet („Subordination und Unvertauschbarkeit der Konstituenten“, Meineke 1991: 45–50).
Nach diesen Ausführungen zu den strukturellen Eigenschaften von KompositaKompositum soll nun noch kurz auf die Funktion von Substantivkomposita eingegangen werden. Die beiden hauptsächlichen Funktionen von Substantivkomposita sind Nomination und Typisierung. Als Benennungs- oder Nominationseinheiten kommt ihnen primär eine Nominationsfunktion zu, weshalb sie sich eignen, wenn neue Bezeichnungen für Begriffe gefunden werden müssen (cf. Barz 1988: 13–14, 46–57; Klos 2011: 28, 235–236). Als komplexen Einheiten kommt ihnen aber gleichzeitig eine Typisierungsfunktion zu (Klos 2011: 85–87). Durch die spezifizierende Bezeichnung von Unterbegriffen tragen Determinativkomposita zur Kategorienbildung bei und sie ermöglichen die Einordnung neuer Erfahrungstatbestände in den Kontext bekannter Erfahrungstatbestände als Spezifizierungen derselben, wobei gleichzeitig das den Erfahrungen gemeinsame als das Kategorielle abstrahiert wird (Solms 1999: 240). Solms (1999: 240) verdeutlicht dies anhand des Beispiels der WortbildungWortbildung Morgenland, die bei Luther anstelle von bisher verwendetem Osten bzw. auffgang der sunnen tritt:
Luther bezeichnet in seiner WortbildungWortbildung einen in der Vorstellung lokalisiebaren Raum, sein Morgenland ist kein ‚Nicht-Ort‘, kein ‚ou tópos‘, kein ‚Nirgendwo‘; sein Morgenland ist ein konkretes und in der Vorstellung von Territorialität bestimmbares Land. Und dieses Land kann sich der zeitgenössische Rezipient als eine Wirklichkeit vorstellen, so wie er z.B. ein Schwabenland, ein Engelland, ein Niderland oder Oberland kennt […].
(Solms 1999: 240)
Unter diesem Aspekt der Nominations- und Typisierungsfunktion von Substantivkomposita ist die Frage nach ihrer Rolle bei der WissensvermittlungWissensvermittlung neuer Inhalte interessant für eine kulturanalytische Betrachtung. Bevor dies aber vorgenommen werden kann, müssen zunächst noch einige theoretische Grundbegriffe geklärt werden.