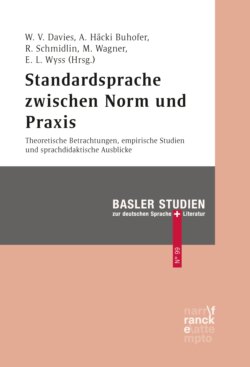Читать книгу Standardsprache zwischen Norm und Praxis - Группа авторов - Страница 15
3. Die sprachliche Situation aus der Perspektive der Soziolinguistik 3.1. Zur Heterogenität des deutschen Sprachraums
ОглавлениеWie Durrell (2002) zeigen wollte, muss diese Vorstellung von dem Verhältnis von Sprache und Nation im 19. Jahrhundert jedoch im Lichte der sprachlichen Vielfalt des deutschsprachigen Raumes hinterfragt werden, denn die Frage stellt sich, wie es angesichts der Heterogenität der damals existierenden Sprachformen zur Annahme einer einheitlichen „deutschen Sprache“ kommen konnte. Auch ist das von Herder, Fichte und nationalistischen Ideologen aufgestellte Postulat, dass eine solche grundlegende „deutsche“ Sprache seit Jahrhunderten (etwa seit dem Karolingerreich, wenn nicht noch früher) existiert habe, eine klare Fiktion. Dieses Postulat fußt jedoch auf verbreiteten Mythen über die Sprache, so wie sie Watts (2011, 2012) beschreibt, und zwar insbesondere auf dem „Mythos der grundlegenden homogenen Sprache“, dem „Mythos der unveränderlichen Sprache“ und dem „Mythos der althergebrachten Sprache“. Watts bezieht sich dabei in erster Linie auf das Englische, aber seine Einsichten lassen sich ohne grundsätzliche Änderungen auf das Deutsche übertragen, denn diese Mythen lassen sich ohne Weiteres im deutschsprachigen Raum belegen – nicht zuletzt weil sich die Skepsis gegenüber dem Konzept der Plurizentrizität letztendlich auf die Annahme des verbreiteten Mythos der grundlegenden homogenen Sprache zurückführen lässt. Auch ist es klar, dass die oben dargestellten Vorstellungen von Herder, Fichte und anderen über Sprache in solchen Mythen verankert sind. Dass sie grundlegende Probleme dieser Vorstellungen erkannt haben könnten, lässt sich gut aus Fichtes Versuch ersehen, die Tatsachen der beobachtbaren sprachlichen Änderungen zu verniedlichen und dadurch die Annahme einer seit Jahrhunderten bestehenden einheitlichen Sprache des Volks zu retten.
Die in Durrell (2002) geäußerten Ansichten über die mit dem Versuch verbundenen Probleme, die Vorstellung einer einheitlichen „deutschen Sprache“ mit der Tatsache der Heterogenität der existierenden Sprachformen zu vereinbaren, liegt die Einsicht von Barbour (1991: 45) zugrunde, die „deutsche Sprache“ sei um 1800 „little more than a standard language spoken by a tiny minority of the population, superimposed on a group of related but highly divergent dialects with often almost no mutual comprehensibility“. Auch Mattheier (2000: 1951) schreibt, dass das Hochdeutsche um diese Zeit „eine minimale soziolinguistische Realität“ gehabt habe. Das „Hochdeutsche“ war nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts eine fast ausschließlich in der Schrift verwendete Varietät, die im Laufe eines (zu dieser Zeit noch nicht vollständigen) schreibsprachlichen Standardisierungsvorgangs entstanden war. Sie wurde allein von einer bürgerlichen Elite verwendet und diese hatte sie nur im Bildungsprozess erwerben können, denn sie war keiner irgendwo gesprochenen Sprachform entstammt, sondern war das Ergebnis eines Selegierungsprozesses unter den regionalen Schreibsprachen der frühen Neuzeit. Haugen (1966) hat die europäischen Standardsprachen, die aus solchen Prozessen hervorgegangen sind, sehr treffend als „kulturelle Artefakte“ bezeichnet, und das gilt in sehr hohem Maße für das Hochdeutsche. Wie Barbour (1991, 1994) dargestellt hat, gibt es keinen rein linguistischen Grund, warum sich aus den regionalen Schreibsprachen der frühen Neuzeit nicht drei oder vier Standardsprachen entwickelten – und letztendlich lässt sich die heutige Plurizentrizität des Deutschen z.T. auf diese Unterschiede zurückführen.
Im Hinblick auf die Vielfalt der gesprochenen Varietäten im deutschsprachigen Raum um 1800 und die Künstlichkeit und soziale Beschränktheit des Hochdeutschen muss gefragt werden, wie eine derartige sprachliche Einheitlichkeit vorausgesetzt werden konnte, die als ethnolinguistische Rechtfertigung für das Streben nach einem Nationalstaat im 19. Jahrhundert angesehen werden konnte. Trotz der oben angeführten Behauptungen von Herder, Fichte und anderen hat es im Karolingerreich natürlich kein einheitliches „deutsches“ Volk mit einer einheitlichen Sprache gegeben, der man dann eine ungebrochene Existenz bis in die Neuzeit zusprechen könnte. Diese Vorstellung war in den gebildeten Bevölkerungsschichten weit verbreitet, das lässt sich jedoch sehr klar auf die gängige Annahme einer (mythischen) grundsätzlich unveränderlichen, homogenen, althergebrachten Sprache zurückführen. Unter anderem widerspricht das Ablösen des Niederländischen aus dem westgermanischen Sprachkontinuum in der frühen Neuzeit und seine Entwicklung als selbstständige Standardsprache der These einer seit frühester Zeit erkennbaren und von den Sprachteilhabern selbst erkannten sprachlichen Einheit eines Volkes, das stets die gleiche „deutsche“ Sprache gesprochen habe (vgl. Durrell 2002, 2009). Mit der verbreiteten Akzeptanz dieser These kamen aber dann auch wissenschaftliche Bemühungen auf, die Geschichte dieser „Nationalsprache“ zu ergründen, die auf eine historisch basierte Legitimierung für einen Nationalstaat hinzielte, dessen Ursprung sich ebenfalls bis in früheste Zeiten zurückverfolgen ließe. Ähnliche Sprachgeschichten mit einer nationalistischen Zielsetzung entstanden zu dieser Zeit in anderen europäischen Ländern, z.B. in England (vgl. Crowley 2003). Die angeblich jahrhundertealte Einheit eines Volkes, das stets das gleiche „Deutsch“ gesprochen hätte, ist letztendlich ein Mythos der nationalistischen Sprachgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert, die das Ziel hatte, die politische Einigung im Nachhinein zu rechtfertigen. Eine „Geschichte der deutschen Sprache“ wurde nämlich geschaffen, um zu beweisen, dass eine als „Deutsch“ erkennbare Sprache, und daher ein „deutsches“ Volk, mindestens seit der Gründung des Karolingerreichs existiert hätte. So gelang es den Sprachhistorikern, das ideologische Konstrukt von einem Volk zu etablieren, dessen Nationalbewusstsein sich bis zum Anfang seiner Geschichtsschreibung mit der Gründung seines ersten Staatsgebildes zurückverfolgen lässt. Dieses Nationalbewusstsein gründet sich seinerseits auf die Perzeption, dass die Mitglieder des Volks die gleiche Sprache redeten, die sie immer noch besitzen und nach der sie sich bezeichnet hatten (vgl. Durrell 2009), und nach der Auffassung der nationalistischen Sprachgeschichtsschreibung hätten sie dieses Bewusstsein einer grundlegenden ethnolinguistischen Einheit durch die Jahrhunderte der politischen Fragmentierung bewahrt. Dieses Konstrukt, das sich auch mit der gleichzeitig aufkommenden Vorstellung der „verspäteten Nation“ bzw. des deutschen „Sonderwegs“ (vgl. Wilson 2016: 3 u. 678) verbinden lässt, hatte einen außerordentlich kräftigen Symbolwert, vor allem weil es die Gründung eines neuen deutschen Nationalstaats durch den Bezug auf einen früheren legitimierte. Indem es auch auf andere gängige Vorstellungen über die deutsche Geschichte anspielt, hat es den Vorteil einer gewissen Plausibilität. Aber das Konstrukt ist letztendlich ein Mythos.