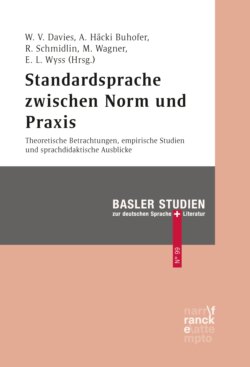Читать книгу Standardsprache zwischen Norm und Praxis - Группа авторов - Страница 21
2. Varianten als Zweifelsfälle
ОглавлениеVarianten mit dem Potenzial, sprachliche Zweifelsfälle zu sein, können auf allen sprachlichen Systemebenen vorkommen und haben verschiedene Ursachen. Manchmal sind sie ein Begleitphänomen des sich durch den Sprachgebrauch allmählich ergebenden Sprachwandels. Wenn eine ältere Variante, z.B. sie gebiert, von der neueren Variante, sie gebärt, dabei ist, abgelöst zu werden, kommt es zu einer Überlappung der Geltung einer älteren und einer neueren Form. Dies fordert entsprechende metasprachliche Erklärungen in den Kodices. Neue oder alternative Formen lösen aber nicht nur Zweifel und Fragen aus – Was ist richtig? Wie soll es heissen? –, sondern unterliegen auch Wertungen, wenn auch zuweilen nur individuellen ästhetischen Präferenzen. Dies zeigen zahlreiche, aus der jüngsten Rechtschreibreform des Deutschen hervorgegangene Formen, die gleichermassen korrekt sind (Albtraum, Alptraum). Zudem kommt es bei jeder Form synchroner Variation innerhalb der Standardsprache, die teils subsistenter, teils aber statuierter und lexikographisch kodifizierter Normierung unterliegt, zu Wertungen. So kann man das Graphem <ß>, das im Schweizerhochdeutschen (ausser in der Schreibung von Eigennamen mit originärem <ß>) nicht praktiziert wird, schöner finden als <ss> und es in einem Text mit Deutschschweizer Autorschaft vermissen; oder man kann in Deutschland und Österreich bedauern, dass die ß-Schreibung neu geregelt worden ist. Mit genau demselben Recht kann man hingegen das <ß> umständlich finden, ja sogar störend beim elektronischen Datenaustausch.
Sprachliche Varianten und somit potenzielle Zweifelsfälle entstehen nicht nur durch Sprach(normen)wandel und Sprachkontakt, sondern auch durch fachsprachliche Prägungen, unterschiedliche Stillagen und regionale sowie – vgl. das soeben erwähnte Beispiel des Graphems <ß> – nationale Variation. Gerade in Produktionssituationen mit hohen Normerwartungen, also in formellen beruflichen und schulischen Kontexten, im öffentlichen Sprachgebrauch und generell bei der schriftlichen Textproduktion, hat man auch als kompetente(r) L1-Sprecher(in) immer wieder Zweifel an der Korrektheit und Angemessenheit bestimmter sprachlicher Formen. Da in der gesprochenen Sprache eine höhere Normtoleranz und Variantenakzeptanz vorliegen, kommen Zweifelsfälle oft erst in der schriftlichen Sprachproduktion auf. Bereits die historische Betrachtung von Zweifelsfällen zeigt die Stigmatisierung sprachlicher Varianz auf. Die Herausbildung der deutschen Schriftsprache vom 18. Jahrhundert an bestand unter anderem gerade darin, Zweifelsfälle, die sich durch Doppelformen ergaben, zu beseitigen. Die Vorstellung, dass Kulturräume durch eine einheitliche Standardsprache zusammengehalten respektive gegeneinander abgegrenzt werden müssen, kulminierte in der Zeit der Herausbildung der Nationalstaaten zudem in der Überzeugung, dass ein Staat im Idealfall durch eine Sprachnation gebildet werden soll, die von einer einheitlichen, „reinen“ Hochsprache umklammert wird. Konsequenterweise wird hier sprachliche Variation als Störfaktor empfunden. Dass nicht nur die Mundarten, sondern auch Standardsprachen dynamische Systeme sind, die keine vollständige Einheitlichkeit aufweisen und ebenfalls räumlich strukturiert sind, wurde unter dem Einfluss der (zunächst anglophon geprägten) Sozio- und Variationslinguistik von der Mitte des 20. Jahrhunderts an zunehmend thematisiert und erforscht.
Was nun die sprachlichen Zweifelsfälle anbelangt, zu welchen die Dynamik von Sprachsystemen führt, so rückt damit der Sprecher selbst in den Fokus, d.h. der Prozess, den die Zweifelsfälle auslösen, nämlich das Zweifeln als Begleitprozess der Sprachproduktion oder der (bewertenden) Sprachrezeption.
Gemäss Klein wurde die Erforschung von sprachlichen Zweifelsfällen lange marginalisiert (Klein 2009: 141). Er spricht dann von Zweifelsfällen, wenn eine Unsicherheit nicht partikulär ist, sondern ein kollektives Problem darstellt. Ein sprachlicher Zweifelsfall liege dann vor,
wenn (kompetente) Sprecher kommunizieren, im Blick auf die eigene Sprachproduktion (plötzlich) über verschiedene sprachliche Möglichkeiten (Varianten) nachdenken und sich nicht (einfach) für eine der bewusst werdenden Möglichkeiten entscheiden können (Klein 2009: 142).
An anderer Stelle sagt er:
Ein sprachlicher Zweifelsfall ist eine sprachliche Einheit (Wort/Wortform/Satz), bei der kompetente Sprecher (a.) im Blick auf (mindestens) zwei Varianten (a, b…) in Zweifel geraten (b.) können, welche der beiden Formen (standardsprachlich) (c.) korrekt ist […] (Klein 2003: 2).
Mit (a.), (b.) und (c.) spezifiziert Klein drei Bedingungen für Zweifelsfälle: dass es sich (a.) um kompetente Sprecher und nicht etwa um Lernende handelt, dass (b.) die Fähigkeit zu zweifeln ein metasprachliches Bewusstsein voraussetzt und dass (c.) die Existenz von Zweifelsfällen auf die Standardsprache beschränkt ist. Als Beispiele nennt Klein: Friede oder Frieden?, Kriegführung oder Kriegsführung?, des Kindes oder des Kinds? Klein fokussiert auf Zweifelsfälle, deren Varianten formseitig teilidentisch sind. Dies ist allerdings für das sprachliche Zweifeln keine Bedingung.
Das zweifelnde Subjekt ist also der kompetente Sprecher. Varianten, die aufgrund mangelnden Wissens von Lernenden erzeugt werden, gelten in dieser Systematik folglich nicht als Zweifelsfälle. Klein (2003) unterscheidet deren drei Typen: Freie Variation: a und b sind ohne Restriktionen gebräuchlich, z.B. gern/gerne. Graduelle Variation: a ist gebräuchlicher als b, z.B. magrer/magerer. Nullvariation: a ist gebräuchlich und richtig, b ist ungebräuchlich und falsch, z.B. Felsblöcke/Felsblocks. Letzterer Typ, die Nullvariation, scheint zunächst mit der Kategorie Fehler zusammenzufallen. Den Unterschied zwischen Fehler und Zweifelsfall sieht Klein (2003: 8) darin, dass ein Fehler nachträglich als solcher erkannt und beurteilt wird. Beim Zweifelsfall hingegen bleibe auch rückblickend der Zweifel, welche der Formen, die zur Wahl stehen, die adäquate sei, bestehen.
Weiter unterteilt Klein die Zweifelsfälle in konditionierte und unkonditionierte. Diese unterscheiden sich darin, dass die Varianten der konditionierten Zweifelsfälle zumindest teilweise in unterschiedlichen Kontexten verankert sind (Klein 2009: 150). Demnach lassen sich Voraussetzungen für die jeweilige Variante bestimmen, z.B. in Bezug auf ihre regionale oder nationale Geltung, die kommunikative Praktik (Fiehler 2000), in der sie geäussert wird, in Bezug auf die individuelle Kommunikationssituation oder die mediale Übertragungsform. Unkonditionierte Zweifelsfälle hingegen können nicht an einen Kontext oder an eine Bedingung gebunden werden. Ihr Gebrauch schwankt unabhängig vom Gebrauchskontext. Sie sind für Klein „Zweifelsfälle im engeren Sinn“ (Klein 2009: 151). In dieser Dichotomie figurieren die Nullvarianten offensichtlich nicht mehr.
Versucht man nun, Varianten des Standarddeutschen nach Kleins Kategorien einzuteilen, zeigt sich, dass es freie Variation gibt, wenn in Österreich sowohl Vorrang als auch Vorfahrt für das ‚Recht, eine Kreuzung oder Einmündung zeitlich vor einem anderen herankommenden Fahrzeug zu passieren‘ verwendet wird; graduelle Variation, wenn die Pluralform Balkone im deutschen Sprachraum insgesamt gebräuchlicher ist als Balkons; konditionierte Variation, wenn in bestimmten Gebieten des Deutschen Sprachraums das E-Mail häufiger vorkommt als die E-Mail (Näheres dazu s. Niehaus Kap. 4.2. in diesem Band) oder wenn die Bevorzugung einer Variante von einem bestimmten Verwendungszusammenhang abhängt. Dies ist beispielsweise bei der lexikalischen ost-österreichischen Variante Obers für ‚oben schwimmender, fetthaltiger Teil der Milch; flüssiger Süßrahm‘ der Fall, für die in Rezepten und in Fremdenverkehrsgebieten auch häufig Sahne gebraucht wird (s. Ammon et al. 2016: 612f.). In Bezug auf die kognitive Verfügbarkeit von Variantenreihen gelingt die Übertragung von Kleins Zweifelsfallmodell, wonach kompetente Sprecher (plötzlich) über verschiedene sprachliche Möglichkeiten nachdenken, nicht in allen Fällen. Auch wenn z.B. für die Bedeutung ‚Recht, eine Kreuzung oder Einmündung zeitlich vor einem anderen herankommenden Fahrzeug zu passieren‘ die Sprecherinnen und Sprecher tatsächlich mehrere Varianten in ihrem mentalen Lexikon zur Verfügung haben dürften, trifft dies nicht bei allen Variantenreihen zu. Um der Dynamik der Variation auch innerhalb der Standardsprache gerecht zu werden, gilt es, Kleins Typen von Zweifelsfällen jeweils mit der spezifischen Sprecherperspektive in Verbindungen zu bringen und zwischen der Eigen- und Fremdperspektive zu differenzieren. Ein Modell, das die Perspektivierung nicht nur im Hinblick auf unterschiedlich konditionierte Textprodukte, sondern auch im Hinblick auf das zweifelnde Subjekt berücksichtigt, ist die Konzeption der Plurizentrik bzw. Pluriarealität von Standardsprachen.