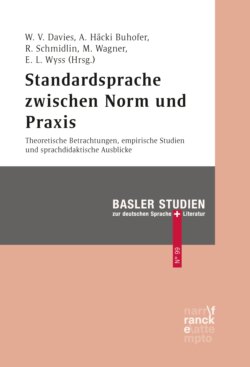Читать книгу Standardsprache zwischen Norm und Praxis - Группа авторов - Страница 23
4. Zur Einschätzung standardsprachlicher Variation
ОглавлениеWie ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt habe (Schmidlin 2011, Schmidlin 2013), gilt aus Sicht der Sozio- und Variationslinguistik das monozentrische Modell zwar als überholt, es ist jedoch dasjenige Modell, auf das im Zweifelsfall zurückgegriffen wird. Aus der Psychologie wissen wir, dass Einstellungen eine affektive, eine kognitive und eine konative Komponente haben. Mit konativ ist gemeint, dass Einstellungen handlungsleitend sind. Wenn wir davon ausgehen, dass das Zweifeln an der Korrektheit und Angemessenheit sprachlicher Varianten eine Form sprachlichen Handelns darstellt und dass dieses Handeln von Einstellungen geleitet wird, lohnt es sich zu fragen, welche Faktoren diese Handlung beeinflussen.
In Schmidlin 2011 werden mittels eines Internetfragebogens bei über 900 Sprecherinnen und Sprechern aus dem ganzen deutschen Sprachraum Gebrauch und Einschätzung nationaler und regionaler Varianten des Standarddeutschen erhoben. Dabei wurde nicht nur die nationale, sondern auch die regionale Herkunft der Gewährspersonen als Einflussfaktoren erfasst, womit dem im vorliegenden Aufsatz vertretenen Postulat der Perspektivierung des Zweifelns entsprochen wird. U.a. wurden die Gewährspersonen gefragt, mit welchem Wort sie den Satz Er stolperte und bemerkte, dass seine … offen waren am ehesten ergänzen würden, wenn sie diesen in einem Brief oder einem Schulaufsatz schreiben müssten. Sie hatten Schuhbändel, Schuhbänder, Schnürsenkel und andere Varianten zur Auswahl. Als markanteste Variantenloyalitätsgrenze zeigte sich hier die Landesgrenze. Die Gewährspersonen aus Deutschland wählten am ehesten diejenige Variante, die gemäss areallinguistischen und lexikographischen Befunden „ihre“ eigene Variante ist – d.h. die Südwestdeutschen wählten Schuhbändel, die Nord- und Mitteldeutschen Schnürsenkel. Mittlere Loyalitätswerte wiesen Gewährpersonen aus Österreich auf: Sie wählten Schuhbänder neben Schnürsenkel. Die Deutschschweizer aber hielten in dieser Versuchsanlage jeweils Schnürsenkel für angemessener – sie wählten die „eigene“ Variante also eher ab. Auch bei der Beurteilung einer Serie von Varianten im Hinblick darauf, ob sie dialektal, eher dialektal, eher standardsprachlich oder standardsprachlich sind – z.B. einlangen, speditiv, Klassenfahrt, besammeln –, zeigt sich die Landesgrenze als kognitive Grenze, halten doch alle Gewährspersonen aus Deutschland die südlichen Varianten eher für dialektal (was aber die Südwestdeutschen interessanterweise nicht davon abhält, „ihre“ Variante im Lückentext zu wählen), während ihnen die Gewährspersonen aus der Schweiz und vor allem aus Österreich eher standardsprachlichen Status zuschreiben. Aber insgesamt zeigt sich, dass am standardsprachlichen Status der empirisch belegbaren und als standardsprachlich kodifizierten Varianten des Standarddeutschen in einer elizitierten Beurteilungssituation generell gezweifelt wird. Inwiefern sie sie für konditionierte Zweifelsfälle halten, konnte mit dem verwendeten Untersuchungsdesign allerdings nicht erhoben werden.
Beim Befund, dass regionale und nationale Varianten trotz ihrer Belegbarkeit in der Mediensprache und trotz ihrer Aufnahme in die einschlägigen Kodices in den Augen der Sprecherinnen und Sprecher Zweifelsfälle sind, wenn sie einzeln und in eingeschränktem textuellen Kontext abgefragt werden, zeigt sich eine gewisse Widersprüchlichkeit, wie sie die Kolleginnen und Kollegen aus Österreich bezogen auf die österreichische Standardvarietät immer wieder erwähnen (Wyss in diesem Band spricht vom „schielenden Blick auf die eigene Sprache“). Im elizitierten Zweifelsfall, in dem Varianten zur Auswahl gegeben werden, greift man offenbar auf ein Standardsprachenkonzept zurück, das auf die National- und Einheitssprachenideologie des 19. und 20. Jahrhunderts verweist (vgl. dazu Elspaß 2005). Warum tut man das? Die Soziolinguistik hat es vor langer Zeit gezeigt, und auch die Laienlinguistik oder Folk-Linguistik weist es nach: Spracheinstellungen beeinflussen das sprachliche Handeln massgeblich. Sie tun dies, weil sich Sprecherinnen und Sprecher über den Sprachgebrauch sozial nach verschiedenen Parametern gegenseitig bewerten. Man schliesst vom Sprachgebrauch auf persönliche und soziale Eigenschaften. Indem wir also aus der Fülle der stilistischen, fachsprachlichen oder auch regionalen Varietäten, die uns zur Verfügung stehen, auswählen, bestärken oder verhindern wir Bewertungen. Sprachbiographisch gesehen werden wir ja bei weitem nicht nur in Lern- und Lehrkontexten für die Art und Weise, wie wir uns sprachlich ausdrücken, bewertet; es ist ein soziolinguistischer Automatismus, den wir selber dauernd erfahren und den wir selber dauernd praktizieren. Dies könnte auch die Variantenskepsis beim schriftlichen Sprachgebrauch, welcher bei den in diesem Kapitel referierten Erhebungen mit ihrem metasprachlichen Fokus den Rahmen bildete, erklären. In der Meinung, gute Standardsprachkompetenz mit variantenfreien Texten nachweisen zu müssen, nimmt man bei der elizitierten Bewertung wenn immer möglich von Varianten Abstand – auch wenn es sich dabei aus linguistischer Sicht nicht um (gefürchtete) Dialektinterferenzen handelt. Der Widerspruch aber zum regelmässigen Vorkommen von Varianten1 in Textsorten, die durchaus Vorbildcharakter haben, bleibt.