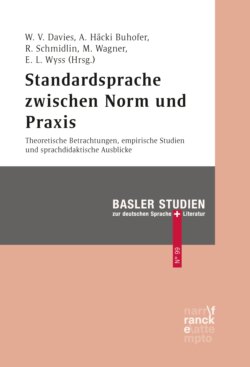Читать книгу Standardsprache zwischen Norm und Praxis - Группа авторов - Страница 28
2. Plurizentrisch oder pluriareal?1
ОглавлениеVor ca. drei Jahrzehnten löste sich die Sprachgermanistik allmählich von der Vorstellung eines mehr oder weniger einheitlichen ‚Binnendeutschen‘ und forcierte plurizentrische Darstellungen zum Standarddeutschen. Wegweisend waren dabei die Arbeiten von Clyne (1992) und besonders Ammon (1995), letztere ist denn auch eingegangen in die Konzeption des VWB und ist von Schmidlin (2011) und Kellermeier-Rehbein (2014) fortgeführt und erweitert worden. Das plurizentrische Modell teilt das Standarddeutsche bzw. den Gebrauch des Standarddeutschen nach Nationen ein, die Deutsch als Amtssprache führen, mit Deutschland, Österreich und der Schweiz als Vollzentren sowie Ostbelgien, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol als Halbzentren (vgl. Ammon 1995: 96). Die deutschen Standardvarietäten fungieren dabei als kodifizierte, amtlich und schulisch institutionalisierte ‚Dachsprachen‘ (vgl. Ammon 1995: 2–4). Variation innerhalb einer Nation wird dabei als nicht varietätenkonstitutiv angesehen, d.h. es gibt nach plurizentrischer Vorstellung z.B. keine ‚bayerische‘ Standardvarietät, sondern „einfache unspezifisch nationale“ oder „sehr unspezifisch nationale“ Varianten innerhalb einer deutschländischen/bundesdeutschen Standardvarietät – dies im Gegensatz zu absolut „spezifisch nationalen“, ausschließlich in einem Land auftretenden Varianten (vgl. hierzu Ammon 1995: 106–110). Theoretisch bedeutet das, dass Mehrheitsvarianten ausschlaggebend für die Nomenklatur und bedeutsamer für das Modell insgesamt sind als Minderheitsvarianten. Das plurizentrische Modell versucht schließlich auch, politisch ‚up-to-date‘ zu bleiben, indem zum einen die sprachgeschichtlich gewachsene Wichtigkeit nationaler Kommunikationsräume betont wird (vgl. von Polenz 1999: 125), zum anderen laut Plurizentrikern ehemalige politische Räume wie die DDR keine Grundlage für eine Varietät des Standarddeutschen (mehr) bilden können, ein Ausschluss, der mit politischen Argumenten (Übernahme der Zwei-Staaten-eine-Nation-Lehre der BRD, vgl. Ammon 1995: 386–389), nicht mit (sozio-)linguistischen begründet wird.
Bereits ab den 1990er Jahren gab es starke Kritik am plurizentrischen Modell. Aus dieser Phase hervorzuheben sind dabei Wolf (1994), Scheuringer (1997), Koller (1999) und – in Reaktion auf Ammon (1995) und von Polenz (1999) – auch noch Reiffenstein (2001). Sie alle wandten sich auf der Basis der Lexik, die damals die bevorzugt beachtete linguistische Ebene war (auch in plurizentrischen Arbeiten), gegen eine rein nationale Gliederung des Deutschen: weil die Existenz des in vielen Fällen ‚grenzüberschreitenden‘ Wortschatzes der standardnahen Alltagssprache der postulierten nationalen Spezifik faktisch widerspreche, weil ein konkretes Zentrum pro Land im Sinne von plurizentrisch nicht auszumachen sei (vgl. zu beidem Wolf 1994: 71–74), weil eine ‚nationale‘ Variante nur eine areale Form von vielen sei (vgl. Scheuringer 1997: 343) und weil kulturpolitisch eine (Über-)Betonung nationaler Spezifika ohnehin bedenklich sei (vgl. Koller 1999: 137). Reiffenstein (2001) nimmt eine Sonderstellung unter den Vertretern des pluriarealen Ansatzes ein: Er schlägt vielmehr ein ‚regio-plurizentrisches‘ Modell vor und betont den Aspekt, dass gerade historische Kontinuitäten in Sprache und Kultur einflussreicher seien als politische Konstrukte, wobei bei dieser historisch-kulturellen Raumkonzeption jedoch durchaus Kernräume und Zentren auszumachen seien (vgl. Reiffenstein 2001: 87–88). Alle oben genannten Kritikpunkte wurden in der Folge immer wieder von Vertretern pluriarealer Modelle aufgegriffen, darunter Eichinger (2005a, 2005b) und Elspaß (2005). Letzterer deutet z.B. an, dass der politisch statt empirisch motivierte, theoretische Ausschluss eines möglichen DDR-Standarddeutsch dem tatsächlichen Sprachgebrauch nicht notwendigerweise folgen muss (vgl. Elspaß 2005: 302–303).
Ein aus heutiger Sicht theoretischer Vorteil des pluriarealen Modells ist es dagegen, über Aussehen und Stärke der Areale weniger strikte Vorannahmen zu tätigen bzw. generell schlicht mehr Möglichkeiten neben der derzeit gültigen nationalen Gliederung in Betracht zu ziehen. Nationale areale Varianten können im pluriarealen Modell immer noch ihren Platz finden, sie sollen ja gleichberechtigt neben arealen Varianten des Standarddeutschen bestehen statt durch diese ersetzt werden.2 Bei Farø (2005) sowie in der jüngeren Diskussion (z.B. Dürscheid et al. 2015) wird ein weiteres Argument vorgebracht: Minderheitsvarianten sollten für eine möglichst exhaustive Beschreibung der Variabilität ebenso für die Konstitution von Varietäten berücksichtigt werden wie Mehrheitsvarianten, vgl. Abb. 1 (adaptiert nach Scherr & Niehaus 2013: 78).
Abb. 1: relative Varianz, adaptiert nach Scherr & Niehaus (2013: 78)
Modellhaft soll hier gezeigt werden, dass sich das Vorkommen einer Variante x und einer Variante y keineswegs auf ein Areal beschränken muss, wie dies hier nur für Variante z gilt. Relative Varianten, die mal Mehrheits- mal Minderheitsvariante sein können (z.B. x in Areal A mit 70 % gegenüber nur 30 % in Areal B), können neben absoluten bestehen. Methodisch soll deswegen die im plurizentrischen Ansatz oft fehlende oder mangelnde Betrachtung der relativen Varianz überwunden werden (vgl. z.B. Dürscheid et al. 2015: 218–219). Neu ist also, dass auch geringere Anteile als 50 % an einer Variable zur Charakterisierung eines Areals berücksichtigt werden können, d.h. auch Minderheitsvarianten eines bestimmten Areals ausdrücklich als dort in Verwendung stehend ausgewiesen werden.
Wie eine Methodik nach dem pluriarealen Modell dabei konkret aussehen kann, werde ich im nächsten Punkt ausführen, und zwar an Beispielen aus dem Projekt ‚Variantengrammatik des Standarddeutschen‘.