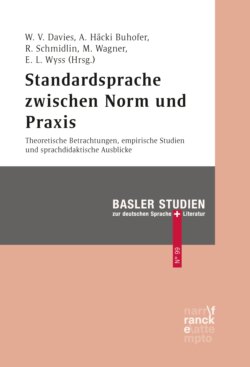Читать книгу Standardsprache zwischen Norm und Praxis - Группа авторов - Страница 38
6. Fazit und Ausblick
ОглавлениеDie Einzelanalysen zeigen, dass in der Grammatik des Standarddeutschen areale Variation durchaus in unterschiedlichsten grammatischen Teilbereichen vorhanden ist und dass diese Arealität bislang als pluriareal einzustufen ist. Einige Vorteile des pluriarealen Ansatzes sind offensichtlich: die höhere theoretische Gewichtung relativer Varianten, die methodische Offenheit bezüglich der Stärke arealer Grenzen und die mit beidem einhergehende vergleichsweise hohe Flexibilität des Korpusdesigns wie generell Anpassungsfähigkeit des Modells an die Empirie. Zur Methodik ist noch zu sagen, dass diese außer den dargestellten Chancen freilich auch ein Risiko birgt: nämlich, einen Ansatz mittels digitaler Großkorpora nur mit linguistischer, nicht aber mathematischer Kritik zu hinterfragen. Bspw. könnte man einwenden, manches Auftreten einer Variante in bestimmten, eigentlich für sie ‚untypischen‘ Arealen komme einfach durch die schiere Masse der Texte zustande und ergebe sich aus reiner Wahrscheinlichkeit: Wenn ein Korpus groß genug ist, wird sich auch irgendwann eine bestimmte Form darin finden, so einflussreich außersprachliche Faktoren auch sein mögen. Hiergegen sind zwei Argumente vorzubringen: Erstens sprechen Fälle dagegen, in denen sehr wohl kein einziger Beleg für eine Variante zu finden ist, trotz der Masse an Texten (z.B. durchwegs im deutschen Nordosten). Und zweitens sind neben dem absoluten Auftreten immer die relativen Zahlen zu beachten – so gehen vereinzelte Belege als ‚statistisches Rauschen‘ sozusagen in der Masse an Belegen für die Gegenvariante unter (z.B. durchwegs im deutschen Nordwesten). Freilich löst das nicht das grundsätzliche Problem, aber es sind doch sehr bedenkenswerte Gegenbeispiele. Und im Grundsatz wäre immerhin noch darauf zu verweisen, dass die ‚Variantengrammatik‘ all diese Daten zugänglich macht, sodass man überhaupt darüber diskutieren kann – präzise Angaben zu Quantitäten bzw. ein zugrundeliegendes systematisch quantitatives Raster findet sich (teilweise auch aufgrund früherer eingeschränkter Möglichkeiten) bisher kaum in Wörterbüchern und Grammatiken, auch nicht in denen mit wissenschaftlichem Anspruch.
Die Erforschung der arealen Variation des Standarddeutschen ist selbstverständlich nicht abgeschlossen, weder in der Grammatik noch in anderen Bereichen. Doch die bisherigen Befunde des Projekts ‚Variantengrammatik‘ zeigen, dass die Einstufung des Deutschen als pluriareale Sprache durchaus ihre empirische Berechtigung hat, wenn Sprachen (auch) über ihre (Standard-)Grammatik von anderen Sprachen abgegrenzt werden sollen.
Sprachdidaktisch wurde dafür argumentiert, die Verzahnung von Sprachdidaktik und Sprachpolitik nicht zu eng zu führen und Variationstoleranz als Grundlage eines selbstbewussten arealen Sprachgebrauchs zu sehen. Allerdings muss abschließend darauf hingewiesen werden, dass für den schulischen Deutschunterricht – wie im Übrigen auch für die universitäre Germanistik – dringend systematisch in größerem Maßstab erforscht werden müsste, in welchem Umfang und mit welcher Methodik areale Varianten des Standarddeutschen überhaupt im Unterricht der deutschsprachigen Länder und Regionen behandelt bzw. allgemein gelehrt werden und welche Auswirkungen eine plurizentrische bzw. pluriareale Orientierung der jeweiligen Didaktik hat. Andernfalls werden Schlussfolgerungen bestenfalls heuristische ‚educated guesses‘ bleiben.