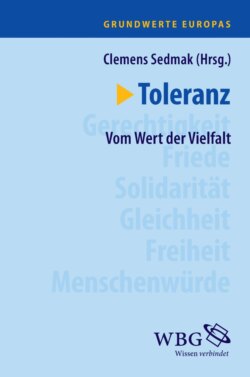Читать книгу Toleranz - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Assisi 1986
ОглавлениеDer 27. Oktober 1986 war ein denkwürdiger Tag in der Geschichte interreligiöser Verständigung. 27 christliche Denominationen waren repräsentiert, 37 Delegationen von 13 nichtchristlichen Religionen waren anwesend, 800 Journalistinnen und Journalisten waren zu diesem Ereignis akkredidiert. Dieser „Weltgebetstag für den Frieden“ war eine sorgsam choreographierte Veranstaltung, zu der Papst Johannes Paul II. eingeladen hatte: Nach einer Begrüßung durch Papst Johannes Paul II. versammelten sich alle Delegierten in der Basilica Santa Maria degli Angeli in einem Halbkreis, der Papst in der Mitte, ihm zur Rechten der Patriarch von Konstantinopel, ihm zur Linken der Dalai Lama. In einer kurzen Ansprache betonte der Gastgeber eine recht verstandene Kultur des Pluralismus, die uns im Zusammenhang mit der Thematik der Toleranz beschäftigt: Er wies auf die Grenzen der Konsensfindung, die irreduzible Diversität, aber auch die Kraft des Zusammenkommens hin: „Die Tatsache, daß wir hierher gekommen sind, beinhaltet nicht die Absicht, unter uns selbst einen religiösen Konsens zu suchen oder über unsere religiösen Überzeugungen zu verhandeln. Es bedeutet weder, daß die Religionen auf der Ebene einer gemeinsamen Verpflichtung gegenüber einem irdischen Projekt, das sie alle übersteigen würde, miteinander versöhnt werden könnten, noch ist es eine Konzession an einen Relativismus in religiösen Glaubensfragen, weil jedes menschliche Wesen ehrlich seinem rechtschaffenen Gewissen folgen muß mit der Absicht, die Wahrheit zu suchen und ihr zu gehorchen. Unsere Begegnung bezeugt nur – und das ist ihre wirkliche Bedeutung für die Menschen unserer Zeit –, daß die Menschheit in dem großen Kampf für den Frieden, gerade in ihrer Verschiedenheit, aus ihren tiefsten und lebendigsten Quellen schöpfen muß, von wo ihr Gewissen geformt wird und auf dem das sittliche Handeln der Menschen gründet.“33 Diese Aussagen erhellen Grenzen, aber auch Kraft des Pluralismus in den Religionen.
Nach diesem ersten Akt wurden die verschiedenen Delegationen zu verschiedenen Orten gebracht, an denen sie gemäß ihrer jeweiligen Tradition einige Stunden beteten. Dabei wurden verschiedene Kirchen, aber auch andere Gebäude benutzt. Der dritte Akt dieses Dramas der Verständigung ab 14 Uhr war eine „Wallfahrt“ der Delegationen von ihren verschiedenen Orten aus auf den Rathausplatz von Assisi. Marcello Zago, ein Mitverantwortlicher des Tages, beschreibt: „I led each delegation in turn to the prayer podium set apart from the large platform on which the Pope’s invited guests sat in a semicircle. This logistic separation was deliberately chosen so that every hint of syncretism was excluded. We were together to pray, each according to his own tradition. Beyond these necessary distinctions, however, a profound sense of respect and communion reigned among all who were present. The square was not a theater where one watched a performance but rather a shrine in which one was present as a participant.“34 Im Rahmen dieses „Versammeltseins an einem Ort, um auf je eigene Weise zu beten“ gab Papst Johannes Paul II. eine Ansprache, in der er wiederum auf Intention und Aussagekraft der Veranstaltung einging: „Mit den anderen Christen teilen wir viele Überzeugungen und besonders, was den Frieden betrifft. Mit den Weltreligionen teilen wir eine gemeinsame Achtung des Gewissens und Gehorsam ihm gegenüber, das uns allen lehrt, die Wahrheit zu suchen, die einzelnen und die Völker zu lieben und ihnen zu dienen, und deshalb unter den einzelnen Menschen und unter den Nationen Frieden zu stiften. Ja, wir alle halten das Gewissen und den Gehorsam gegenüber der Stimme des Gewissens für ein wesentliches Element auf dem Weg zu einer besseren und friedvolleren Welt. Könnte es anders sein, da doch alle Männer und Frauen in dieser Welt eine gemeinsame Natur, einen gemeinsamen Ursprung und ein gemeinsames Schicksal haben? Wenn es auch zwischen uns viele und bedeutsame Unterschiede gibt, so gibt es doch auch einen gemeinsamen Grund, von wo her es zusammenzuarbeiten gilt für die Lösung dieser dramatischen Herausforderung unserer Zeit: wahrer Friede oder katastrophaler Krieg?“ Danach wies er auf das Gebet als das Fundament des Friedens hin. Johannes Paul II. drückte die Überzeugung aus, „daß der Friede die menschlichen Kräfte weit übersteigt, besonders in der gegenwärtigen Lage der Welt, und daß deshalb seine Quelle und Verwirklichung in jener Wirklichkeit zu suchen ist, die über uns allen ist.“ Die Auslegung dieser Wirklichkeit ist in verschiedenen Religionen und Traditionen unterschiedlich; ein Zusammenkommen verstärke dieses Bewusstsein der jeweiligen Besonderheit, doch habe der Weltgebetstag für den Frieden die „Verantwortung jeder Religion für das Problem von Krieg und Frieden bewußter gemacht.“ Der Schlussakt des Tages wurde in einem gemeinsamen Mahl gesetzt.
Der Tag ist bis heute Gegenstand theologischer und kulturwissenschaftlicher Reflexionen, die gerade auch mit der Frage nach „Toleranz“ zu tun haben. Einige Eckpunkte aus Sicht der Toleranzforschung: (1) Nähe lässt Differenzen wie Gemeinsamkeiten klarer hervortreten; (2) es gibt brennende Fragen, die es praktisch unerlässlich wie ethisch geboten erscheinen lassen, das Gemeinsame vor dem Trennenden zu betonen und sich zu einer Gesinnungsgemeinschaft in diesen Fragen zusammenzuschließen; (3) ein Dialog, in dem Heiliges und Existentielles (Religion und Friede) involviert sind, muss sorgsam geplant sein, weil Details symbolisch aufgeladen sind; (4) die Verschiedenheit lässt aus einer Vielheit von Quellen schöpfen, was für die in (2) betonten Anliegen fruchtbar ist.
Assisi hat bei aller Kritik35 auf die Entwicklung einer Haltung geachtet.36 Eine Grundfrage lautet beispielsweise: Worin besteht der an diesem Tag zum Ausdruck gebrachte Unterschied zwischen „being together in prayer“ versus „praying together“? Hier wird eine Behutsamkeit, eine „heilige Scheu“ deutlich, die jener fundamentalen Disposition nahe steht, die „Pluralismus als Lebensform“ und „Toleranz als Lebensweise“ ermöglicht. Assisi hat die Kultivierung einer Haltung genährt. Einer Haltung von Sorge um das „globale Gemeinwohl“ und einer Haltung von Achtung gegenüber Andersdenkenden und Andersempfindenden. So kann man „Toleranz“, verstanden als „dispositionalen Begriff“37,mit einer Haltung vergleichen, die dem entspricht, was man im Lateinischen „magnanimitas“ nennt. Damit ist eine Haltung der Weitherzigkeit gemeint, die ohne große innere Anstrengung mit verschiedenartigen Menschen und Ideen umzugehen versteht.