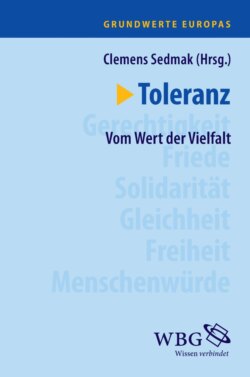Читать книгу Toleranz - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Formen der Toleranz und ihre Korrespondenz zur Integration
ОглавлениеDoch lässt sich die Reflexion über Toleranz innerhalb der modernen liberalen Staaten nicht von der Integrationsthematik lösen. Schließlich kann die Forderung nach Integration gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, vorübergehend anwesenden Arbeitskräften oder Flüchtlingen von der Ermahnung zur Achtung der Gesetze des Gastlandes oder Einwanderungslandes bis zum Ansinnen völliger kultureller Assimilation, über die sich Erdogan so sehr empörte, sehr Unterschiedliches bedeuten und entsprechend von verschiedenen Forderungen nach Toleranz begleitet oder auch durch diese gekontert werden. Die Achtung vor dem Gesetz gilt normalerweise als unverzichtbar. Bereits bei John Locke galt die Toleranz, für die er so intensiv stritt, aber nicht für Katholiken und Atheisten: Deren Loyalität gegenüber dem Gemeinwesen sei nicht gesichert,10 denn die einen vernachlässigten bereits ihre natürliche Pflicht zur Gottesverehrung,11 die anderen stellen eine andere Autorität über die bürgerliche Rechtsprechung. Wo eine demokratisch legitimierte staatliche Ordnung existiert, gibt es auch heute keine ernsthaften Kompromissmöglichkeiten: Wer glaubt aus religiösen oder aus moralischen Gründen gegen das Gesetz verstoßen zu müssen, hat auch die rechtliche Strafe auf sich zu nehmen. Natürlich bleibt die Möglichkeit, durch zivilen Ungehorsam auf die schwierige Lage bestimmter Gruppen aufmerksam zu machen und nach Verbesserung zu suchen. In Fällen, in denen de facto ein Rechtspluralismus herrscht, wird man sich bemühen müssen, durch Aushandlung eine wechselseitige Duldung zu erreichen, die nicht auf Kosten der Menschenrechte geht.12 Hier verlangt der demokratische Staat im ganz klassischen, wörtlichen Toleranzsinn von allen seinen Bürgerinnen und Bürgern das Erdulden auch solcher mit dem Recht konformen Lebensformen, Ansichten und Handlungsweisen, die ihnen persönlich zuwider sind.
Hingegen gibt es durchaus gute Gründe, gegenüber Forderungen nach Assimilation den Wunsch nach Achtung kultureller Besonderheiten von Minderheiten ernst zu nehmen. Verunsicherte junge Menschen mit irgendwie begründeten Inferioritätsgefühlen sind seit jeher leicht zu von Verblendung begleiteten, übersteigerten Gegenreaktionen zu verleiten, die mit Lust zur Selbstaufopferung verbunden sein können, nicht erst, seit hunderte junger Europäer mit und ohne Migrationshintergrund in den Djihad im Nahen Osten ziehen.13 Nicht nur unter den Jugendlichen der unterschiedlichsten Minoritäten macht sich zudem seit Längerem eine Erscheinung breit, die man als „reaktiven Kulturalismus“ (reactive culturalism) bezeichnet hat: Das Sperren gegen die Integration durch Betonung kultureller Besonderheiten und überhöhte Gruppenidentifikation.14 Dabei spielt es eher eine Nebenrolle, ob die Identifikation nationalistischen oder ethnischen oder religiösen Mustern folgt, entscheidend ist ihre stabilisierende Funktion. Bei einigen Emigrantengruppen ist bekanntlich ein starker Nationalismus verbreitet15, in anderen Fällen bietet eine Religion die Möglichkeit zur Identifikation und zur wechselseitigen Stabilisierung in fremder, als feindlich empfundener Umgebung. Ein reiner Republikanismus von offizieller Seite, welcher die faktisch vorhandenen sozialen Heterogenitäten und daraus resultierenden Spannungen übergeht, ist in dieser Situation für das republikanische Gemeinwohl kontraproduktiv, weil die Spannungen nicht angesprochen und auf politischem Wege gelöst werden können. Welche Art von gruppenspezifischer Berücksichtigung kann jedoch solch zentrifugales Verhalten in Grenzen halten?
In den letzten Jahrzehnten formulierte man u.a. von kommunitaristischer Seite Formen solch gruppenspezifischer Berücksichtigung durch einen erweiterten, emphatischen Toleranzbegriff, oder man stellte der Toleranz die Anerkennung entgegen, häufig unter Rückgriff auf ein Goethewort: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt Beleidigen.“16 Allemal führte die anschließende Diskussion zu einer Auffächerung des Toleranzbegriffs, die mit den schon angedeuteten Variationen im Verständnis der Integration korrespondiert. Als ein Differenzierungskriterium dient die Frage, inwieweit eine bloße Duldung vorliegt und inwiefern man von der Anerkennung oder gar Wertschätzung der betroffenen Menschen und ihrer Auffassungen sprechen kann.
Michael Walzer bestimmt Toleranz als das Akzeptieren der Differenz, wobei er es für weniger wichtig erachtet, aus welcher Gemütslage dieses Akzeptieren erfolge, ob es sich nun um „eine resignierte Duldung der Differenz um des Friedens willen“, also aus Schwäche, oder aber um eine „enthusiastische Bejahung der Differenz“ handle.17 Entscheidend sind für ihn die sehr unterschiedlichen politischen Strukturen, innerhalb deren Toleranz zum Tragen kommen kann, ob es sich um multinationale Imperien, Konföderationen, Nationalstaaten oder Einwanderungsgesellschaften handelt. Natürlich ist die Lage von Minderheiten, die relativ häufig Toleranz in Anspruch nehmen oder auch nur auf Duldung hoffen müssen, in einem Nationalstaat mit einer Bevölkerung, die sich selbst gegenüber den Zuwanderern als relativ homogen versteht, anders als in einem „klassischen“ Einwanderungsland, in dem seit jeher unterschiedliche Gruppen zusammenfinden müssen.18 Bei Walzer lässt sich somit eine erweiterte Verwendung des Wortes Toleranz erkennen, die etwa auch reines Erdulden aus Schwäche einerseits, aktive Förderung andererseits als sinnvollen Gebrauch des Wortes „Toleranz“ akzeptiert.
Zu einer Toleranz im engeren Sinn des Wortes, wie sie vielleicht am treffendsten von Rainer Forst definiert wird, gehört neben der unbestreitbar vorhandenen „Akzeptanz-Komponenente“ stets auch eine „Ablehnungskomponente“, die lediglich von der Akzeptanzseite überwogen wird, solange die „Grenzen der Toleranz“ noch nicht erreicht sind. Ferner legt Forst Wert darauf, dass Toleranz freiwillig ausgeübt werde, von daher allemal vom bloßen Erdulden verschieden sei.19 Um auf der anderen Seite der Skala bei der Form von Akzeptanz, die man als Wertschätzungskonzeption der Toleranz bezeichnen kann, noch von Toleranz reden zu können, müsse sich die Wertschätzung auf Aspekte der tolerierten Haltung, bei gleichzeitiger Ablehnung anderer Aspekte beziehen. Eine weniger aufgeladene Version der Akzeptanz, die Respekt-Konzeption bezieht sich auf die Achtung vor der Autonomie der tolerierten Personen. Er unterscheidet hier wiederum eine formale von einer qualitativen Gleichheit der angesprochenen Personen, je nachdem, ob deren religiöse, moralische und traditionsgebundene Positionen in den Bereich des Privaten verwiesen werden oder aber Teil der öffentlichen Präsenz sind. „Wechselseitige Toleranz impliziert diesem Verständnis nach den Anspruch anderer auf vollwertige Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft, ohne zu verlangen, dass sie dazu ihre ethisch-kulturelle Identität in einem reziprok nicht forderbaren Maße aufgeben müssen.“20 Darauf werden wir gleich zurückkommen.
Zwei weitere Konzeptionen von Toleranz, die für unseren Kontext eine Rolle spielen, nennt Forst ebenfalls: Eine Erlaubnis-Auffassung, bei der ein Fürst oder eine in ihrer Dominanz ungefährdete Mehrheit einer Minderheit Toleranz gewähren, sei dies aus prinzipiellen oder pragmatischen Gründen, d.h. aus moralischer Überzeugung oder um der Friedenssicherung willen. Bei der Koexistenz-Form ist mehr oder minder gleichstarken Gruppierungen klar, dass sie einander wechselseitig hinzunehmen haben. Dies kann mit der Konfliktvermeidung aus Kostengründen – „Kosten“ im weiten Sinne verstanden – beginnen, um dann zu partieller oder auch weitgehender Kooperation fortzuschreiten. Gegenüber dem ursprünglichen Konfliktgrund findet eine zunehmende Neutralisierung statt, wie Carl Schmitt es am Beispiel der christlichen Konfessionen in Deutschland ausgedrückt hat.21
Die Rechtfertigung der Toleranz, der Forderung nach Toleranz selbst bindet Forst anhand einer „rekursiven Reflexion“ über die relevanten Rechtfertigungsstrukturen „an eine unbedingte Pflicht zu bzw. ein fundamentales Recht auf Rechtfertigung […], das allen Menschen als Menschen – als rechtfertigenden, endlichen Vernunftwesen – zukommt, unabhängig von ihren spezifischen Eigenschaften, Überzeugungen und Identitäten […].“22 Auch dies wird nochmals zur Sprache kommen.
Der anhand der Niederlande und der Situation in Frankreich beschriebene Konflikt, der sich mit eher geringfügigen Modifikationen natürlich in vielen europäischen Ländern findet, insbesondere auch in Deutschland, lässt sich demnach dadurch beschreiben, dass von Seiten der „autochthonen“, schon länger ansässigen Bevölkerung gegenüber Migranten, auch der zweiten und dritten Generation, mehr oder minder selbstverständlich eine Erlaubnis-Version der Toleranz unterstellt wird, für welche die Mehrheit in Form der völligen Assimilation belohnt zu werden beansprucht, während auf der anderen Seite die Forderung nach Akzeptanz erhoben wird, nicht selten in der emphatischen Wertschätzungsvariante. Eine gewisse Fehleinschätzung auf Seiten autochthoner Politikerinnen und Politiker besteht in einigen Fällen darin, dass man – in den von Walzer getroffenen Differenzierungen formuliert – das eigene Land als homogenen Nationalstaat versteht, während man es de facto mit einem Einwanderungsland zu tun hat, selbst wenn dieses deutliche strukturelle Unterschiede zu traditionell multikulturellen Staaten wie Kanada aufweist. Die Begriffsanalyse schafft somit nicht das Problem aus der Welt, indem sie einen Standpunkt „oberhalb“ der streitenden Parteien einnimmt, vermag jedoch innerhalb der Diskussion unter den Beteiligten den Weg zu einer gemeinsam Sprache erleichtern, indem sie deutlich werden lässt, warum beim Gebrauch derselben Wörter von unterschiedlichen Personen sehr Verschiedenes gemeint sein kann.
Auf der Basis dieser begrifflichen Differenzierungen lassen sich gleichwohl erste Resultate zusammenstellen: Die moralische Grundlage der Forderung nach Toleranz ist die nach unparteilicher Berücksichtigung aller auch als Zwecke an sich selbst, als mögliche Quellen eines vernünftigen Arguments und Träger prima facie berechtigter Interessen. Inwieweit dieser Grundsatz der Moralität „westlichem“ Denken entspricht und in welcher Form er letztlich doch weltweit Akzeptanz beanspruchen kann, soll im nächsten Abschnitt kurz erwogen werden. In jedem Fall impliziert er eine Toleranz im Sinne des Respekts vor der Autonomie der anderen Person, also als einer Form der Akzeptanz. Grundsätzlich ist niemand befugt, sich willkürlich in die Rolle dessen zu begeben, der anderen Menschen die persönliche Sphäre der Entscheidungsfreiheit per Erlaubnis oder Verbot erweitert oder einengt, etwa weil er zur Mehrheit und die andere Person zur Minderheit gehört. Stets müssen Kriterien der Wechselseitigkeit und Allgemeinheit berücksichtigt werden. Dabei muss die zu tolerierende Position oder Verhaltensweise keineswegs den Verallgemeinerungsforderungen genügen, wohl aber sind die Grenzen der Toleranz nach diesem Maßstab zu bestimmen. Dies hat nichts mit Indifferenz gegenüber den ungeliebten Verhaltensweisen der betroffenen Personen zu tun und auch nichts mit der Frage, ob alle Mitglieder einer Toleranz beanspruchenden Minorität gewillt sind, die Reziprozität des Respekts einzuhalten. Allemal werden sich die Eingriffsmöglichkeiten des Rechtsstaats gegenüber Gruppen, die teilweise oder als Ganzes aggressives Gebaren gegenüber der Mehrheitskultur an den Tag legen, auf das Sanktionieren rechtswidrigen Verhaltens und gegebenenfalls den Entzug finanzieller Zuwendungen für kulturelle Aktivitäten zu beschränken haben. Zudem kann man deutlich machen, dass derartige Aggressionen keine Wertschätzung genießen, indem man eben diese Wertschätzung gegenüber anderen Elementen, sei es derselben, sei es anderer minoritärer oder auch majoritärer Kulturen durch entsprechende Förderung zum Ausdruck bringt. Soviel zunächst zur Sorge vor angeblich unterschiedsloser Toleranz.
Es wurden bereits pragmatische Gründe dafür angeführt, um des Gemeinwohls willen, zur Vermeidung eines „reactive culturalism“ besondere Rücksicht auf die Befindlichkeiten verunsicherter Minderheiten zu nehmen. Es gibt jedoch zwei grundsätzliche Argumente, die Integration von Minderheiten nicht als bloße Assimilation an die Mehrheitskultur zu deuten, die mitunter in einem Verständnis der Toleranz im emphatischen, über die bloße Duldung weit hinausgehenden Sinne der Anerkennung einer Minderheit als Trägerin einer eigenen, schützenswerten Kultur zusammenkommen. Dies ist zum einen der Gedanke, dass eine moderne Gesellschaft von der Vielfalt und dem Reichtum ihrer kulturellen Ausprägungen nur profitieren kann, wenn diese unter dem Dach eines gemeinsamen Rechtssystems in jenen „edlen Wettstreit“ treten, von dem bereits Kant im „Ewigen Frieden“ spricht. Dies ist zum anderen die These, dass Minderheiten ein Recht auf Wahrung ihrer kulturellen Identität haben. Eine dabei diskutierte Frage ist, ob Minderheitenrechte stets die Rechte der zur Minderheit gehörenden Individuen sind, oder ob es auch der Rechte bedarf, welche der Gruppe als Ganzes zukommen und die möglicherweise sogar die liberalen Individualrechte außer Kraft setzen können, um den Bestand der Kultur zu sichern. Es ist kein Zufall, dass die inzwischen klassische Stellungnahme dieser Art von einem der exponierten Vertreter des Kommunitarismus, nämlich von Charles Taylor, stammt. Taylor betont „den dialogischen Charakter menschlicher Existenz“23 und die daraus resultierende „Wichtigkeit der Anerkennung“,24 insbesondere der Anerkennung der unverwechselbaren Identität. Diese „unverwechselbare Identität eines Individuums oder einer Gruppe anzuerkennen“ verlange nun eine „Politik der Differenz“, zu welcher der „differenz-blinde“ und daher letztlich intolerante Liberalismus nicht in der Lage sei.25
Gewiss könne auch dieser auf strikte Nicht-Diskriminierung bedachte Liberalismus Maßnahmen wie positive Diskriminierung begründen, welche vorangegangene Nachteile ausgleichen sollten.
Aber bestimmte Maßnahmen, die heute unter Berufung auf die Differenz gefordert werden, lassen sich mit dieser Argumentation nicht rechtfertigen – solche Maßnahmen nämlich, die nicht auf Wiederherstellung eines ‚differenz-blinden‘ Spielraums zielen, sondern darauf, die Besonderheit zu wahren und zu pflegen, nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern für immer. Was aber wäre, wo es um Identität geht, legitimer als danach zu streben, daß sie niemals verloren geht?26
Der Vorwurf, gerade der „differenz-blinde“ universalistische Liberalismus diskriminiere die Angehörigen von minoritären Kulturen schon dadurch, dass sie gezwungen würden, sich den ihnen fremden Formen und Kriterien der Hegemonialkultur anzupassen und zu unterwerfen, greift wieder die Kritik an der republikanischen (französischen) Form der Integration auf.27 In Forsts Terminologie kann man innerhalb dessen eine Forderung nach qualitativer statt bloß formaler Interpretation der Respekt-Konzeption der Toleranz erkennen. Im nächsten Abschnitt soll darüber hinaus – im Kontext der Frage nach der möglichen Intoleranz universalistischer Moralität – auch kurz untersucht werden, inwieweit dieser Universalismus selbst „differenz-blind“ ist. In Abschnitt 4 werden wir überlegen, ob eine tolerante Gesellschaft verpflichtet ist, die kulturelle Identität ihrer Minderheiten durch Wertschätzung ihrer kulturellen Besonderheiten zu bewahren.
Da auch für Taylor die Anerkennung der möglichen Gleichwertigkeit verschiedener Kulturen, weil jeder Mensch das Recht haben müsse, seine traditionelle Kultur als wertvoll anzusehen,28 nicht die Akzeptanz aller „Hervorbringungen“ einer jeden Kultur impliziert, nur die Bereitschaft, sich unvoreingenommen auf sie einzulassen, wird eine weitere Differenzierung erforderlich, die bereits hier angesprochen sei.29 Weder Kulturen noch ihre Hervorbringungen sind in der Art von Menschen deshalb schutzwürdig, weil es sie eben gibt.30 Insofern wird man wieder auf Reziprozität und Allgemeinheit zurückgreifen müssen, will man sich weder durch kulturelle Toleranz und das Recht auf Differenz zur Duldung massiver Menschenrechtsverletzungen bewegen lassen, noch bestimmte Minderheiten benachteiligen, von der diskursiven Suche nach gerechten Verhältnissen ausschließen und dann zu Friedfertigkeit und Toleranz aufrufen – so hatte Forst Herbert Marcuses Formel von der „repressiven Toleranz“ aufgegriffen.31 Man kann als generelle Regel gegenüber dem Brauchtum von Minoritäten, speziell solchen von Migranten, etwas mehr an Großzügigkeit, an Toleranz im Erlaubnis-Sinn einräumen, um den Eindruck einer völligen Ablehnung ihrer Ursprungskultur zu vermeiden und den Nachteil etwas auszugleichen, dem Menschen in einer fremden Umgebung, generell als Teil einer Minderheit nun einmal unterliegen. Dieses Entgegenkommen hat seine Grenzen bei Grundrechtsverletzungen von Beteiligten und bei eklatanter Benachteiligung anderer Gruppen und lässt sich ansonsten eher als politisch wünschenswerte Haltung von Seiten der Offiziellen und der Mehrheitsbevölkerung denn als Rechtsanspruch der Minderheiten verstehen.
Wie schwierig diese Grenze zu ziehen ist und wie wichtig eine kontinuierliche öffentliche Debatte bleibt, mögen drei aus der öffentlichen Diskussion bekannte Beispiele zeigen: Während sich in den meisten Ländern, jedenfalls des sogenannten Westens, ein Konsens für das sanktionsbewehrte Verbot von Mädchenbeschneidung finden dürfte, führte die Entscheidung des Landgerichts Köln vom 7. Mai 2012, das die religiöse Beschneidung eines Vierjährigen durch einen Arzt als Körperverletzung i.S.d. § 223 StGB wertete, zu einer hochemotionalen Debatte, in der sich jüdische wie muslimische Sprecher in den Grundfesten ihrer Identität bedroht sahen. Es können hier bei weitem nicht alle Aspekte der vielschichtigen Diskussion um Religionsfreiheit und Recht auf körperliche Unversehrtheit angesprochen werden. Ein eher wenig beachteter Punkt war die pragmatische Überlegung, dass man die betroffenen Jungen nicht effektiv würde schützen können, sondern vielleicht sogar im Gegenteil einer nicht den Hygienestandards genügenden heimlichen Behandlung ausliefern könnte. Ein gesetzlicher Eingriff scheint daher aus vielerlei Gründen nicht angemessen, doch könnte man eine Diskussion innerhalb der betroffenen Religionen anregen, ob nicht ein symbolischer Beschneidungsvorgang heute zeitgemäßer und ausreichend wäre.
Seit Jahren schwelt zudem in verschiedenen europäischen Staaten der Streit um das tatsächliche oder vermeintliche Recht islamischer Frauen und Mädchen, in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit ein Kopftuch oder auch eine Burka zu tragen. Nicht selten wird dies zum Prüfstein christlicher oder auch europäischer Toleranz erklärt. Umstritten ist insbesondere, inwieweit der Staat berechtigt sein kann, in öffentlichen Räumen, speziell innerhalb der Schule, das Tragen des Kopftuchs durch Schülerinnen oder Lehrerinnen zu untersagen. Während der französische Staat ein Gesetz verabschiedete, welches den Schülerinnen das Zeigen jeglicher religiöser Symbole verbot, beschlossen nach einem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts diverse deutsche Länderparlamente Regelungen, die manchmal generell religiöse Symbole, manchmal speziell muslimischen Lehrerinnen das Tragen des Kopftuchs untersagen. Mitunter wird explizit versucht, christliche, aber auch jüdische, Symbole von diesem Verbot auszunehmen, etwa die Ordenstracht unterrichtender Nonnen, ein Versuch, den das Bundesverwaltungsgericht für Baden-Württemberg für unzulässig erklärt hat, ebenso hat es im Juni 2008 einer deutschen Muslimin anlässlich ihrer Klage gegen das Bundesland Bremen das Recht eingeräumt, während des Refendariats das Kopftuch zu tragen. In Frankreich und Belgien gilt seit 2011 ein Burkaverbot, das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 2014 für rechtens erklärt wurde, weil der Ganzkörperschleier eine Barriere zwischen Trägerin und Umwelt errichte, somit das Zusammenleben in der Gesellschaft erschwere. Martha Nussbaum sieht in diesem Verbot ein Zeichen religiöser Intoleranz und nennt für einige der gängigen Argumente mehr oder minder gute Gegengründe, die zumeist auf die Inkonsequenz staatlichen Verhaltens angesichts paralleler Sachverhalte ohne muslimischen Hintergrund verweisen, hinsichtlich der Barriere etwa auf winterlich dick vermummte Menschen.32 Letzteres mag als Beispiel für begrenzte Wirksamkeit ihrer Argumente dienen, da ein vorübergehender Schutz vor der Kälte doch deutlich verschieden ist vom andauernden Schutz vor dem Gesehenwerden durch andere Menschen.
Während das Tragen der Burka besonders in Deutschland eher wenige Frauen betrifft, war die Diskussion um das Kopftuch deutlich intensiver. Die Gründe für und gegen das sogenannte Kopftuchverbot sind bekannt und überschaubar: Auf der einen Seite führt man die Religionsfreiheit, den Respekt vor der Achtung religiöser Gebote durch Menschen eines Minderheitenglaubens, die Suche muslimischer Frauen nach eigener Identität und die weltanschauliche Neutralität des liberalen Staates selbst gegenüber ungewöhnlichen und extremen religiösen Positionen an, solange diese weder andere Menschen noch die öffentliche Ordnung gefährden. Genau Letzteres wird jedoch von denen, die ein Verbot durchsetzen wollen, als wesentliches Argument angeführt: Es handle sich, da es kein vom Koran zwingend vorgeschriebenes und kein von allen muslimischen Frauen anerkanntes Gebot zum Kopftuchtragen gebe, gerade um eine radikale und bewusste Wendung gegen die demokratische politische Ordnung im Namen radikaler Religiosität. Ferner sei das Kopftuch ein Symbol der Geschlechterhierarchie und der sexistischen Unterdrückung, die mit den Grundsätzen des liberalen Staates unvereinbar sei.33
Demgegenüber lässt sich, wiederum in Anwendung der Grundsätze liberalen Rechtsdenkens, einwenden, kaum allen muslimischen Kopftuchträgerinnen oder auch ihren Ehemännern, Vätern, Brüdern könne man radikale und demokratiefeindliche Gesinnung unterstellen. Ferner hat, wer ein bestimmtes Kleidungsstück trägt, erstens zunächst die Vermutung für sich, dass sie dies freiwillig tut, zweitens gilt, da bestimmte Formen der religiösen Gesinnung offenbar (zurecht) als gesellschaftsbedrohend angesehen werden, auch hier erst einmal die Unschuldsvermutung, will sagen, dass nicht Staatszerstörung, sondern Traditionsbewusstsein und vielleicht die Identitätssuche den persönlichen Hintergrund für das Tragen eines Kleidungsstückes darstellt. Solange wir nicht wissen, ob sexistischer Zwang oder eine Suche nach Halt in den als eigen angesehenen – auch religiösen – Traditionen das Motiv für dieses Verhalten ist, sollten wir einerseits diesen Halt nicht verwehren und andererseits weniger das (mögliche) Symbol der Unterdrückung als die Unterdrückung selbst zur Zielscheibe unserer Angriffe machen. Zu diesem Zweck kann es gerade hilfreich sein, wenn wir die muslimischen Frauen und Mädchen von eventuellen Streitigkeiten um derartige Äußerlichkeiten entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf grundlegendere Probleme zu konzentrieren. Aus dieser Sicht scheint es – um kurz zur Burka zurückzukehren – auch überzogen, einer Frau mit Burka den Zutritt zu einem Essener Schulhof zu verwehren (Spiegel-Online 26. November 2014).
In einigen Teilen der Welt wird, wie eingangs angesprochen, die Toleranz gegenüber der Homosexualität als Zeichen des Niedergangs „des Westens“ gewertet. Die darin enthaltene Unterstellung von Indifferenz und Gleichgültigkeit übersieht oder ignoriert, dass die Entscheidung zur Liberalisierung des rechtlichen Umganges mit der Homosexualität das Ergebnis intensiver Diskussionen war, die – speziell im angelsächsischen Raum – sich um das von John Stuart Mill aufgestellte Prinzip drehten, dass der einzige Grund, aus dem sich Staat und Gesellschaft in das Verhalten der Menschen einzumischen befugt sind, darin besteht, sich und die anderen Menschen zu schützen.34 In England gab es im Anschluss an die heftige Kritik, die Lord Devlin an diesem Prinzip übte, mit der These, die Gesellschaft habe das Recht, ihre Moral – etwa im Hinblick auf Homosexualität – mittels des Strafrechts durchzusetzen eine intensive Debatte, an der sich u.a. auch H.L.A. Hart und Ronald Dworkin beteiligten.35 Zu den Argumenten, die schließlich den Ausschlag gaben, gehörte die Überlegung, dass es nicht die Gesellschaft, sondern eben eine Mehrheit ist, die ihre Überzeugungen erzwingen will, dass es für diejenigen, die homosexuelles Verhalten für unmoralisch halten, keinen Grund zu der Annahme gibt, dass die gesellschaftliche Moral als Ganzes leide und dass es keinen empirischen Beleg für die moralische Schädlichkeit dieses Verhaltens gebe. Es war, wie gesagt, nicht Beliebigkeit, sondern kollektive Einsicht nach intensiver Diskussion, die in Deutschland zur Abschaffung des § 175 StGB führte.