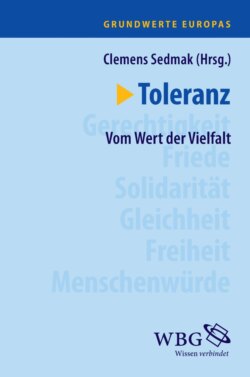Читать книгу Toleranz - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine hausgemachte Sackgasse
ОглавлениеJohn Horton und Susan Mendes merken in der Einleitung zu ihrem Sammelband Toleration, Identity, and Difference an, dass das Problem der Differenz das zentrale Thema von Toleranz und Tolerierung sei („[toleration] is about ‚difference‘ in general“, S. 4). Als analytischen Rahmen zur Diskussion dieser Problematik schlagen sie den politischen Liberalismus vor und werfen folgende Rawlsche Frage auf: „How is it possible that there may exist over time a stable and just society of free and equal citizens profoundly divided by reasonable religious, philosophical and moral doctrines?“ (S. 3) – d.h. wie kann eine stabile und gerechte Gesellschaft freier und gleichberechtigter Bürger, die grundlegend durch vertretbare religiöse, philosophische und moralische Lehren gespalten ist, langfristig existieren? Nun ist nicht jeder liberale politische Theoretiker auch analytischer Philosoph, wenngleich sich viele davon als solche verstehen. Wie das Zitat zeigt, beginnt hier bereits das Hauptproblem der analytischen Philosophie (ebenso wie liberaler politischer Theorie). Dieses liegt in den erkenntnistheoretischen Grundannahmen und den daraus resultierenden praktischen Schlussfolgerungen. Dabei sind nicht einmal unbedingt die Schlussfolgerungen selbst das Problem (so gibt es beispielsweise gute Gründe, einen liberalpolitischen Staat einer Diktatur vorzuziehen7), sondern die zugrunde liegenden Annahmen, durch die sie erreicht werden. Beide stellen sich nämlich immer dann als problematisch heraus, wenn die grundlegenden Annahmen nicht geteilt werden. Dann drohen erstens die theoretischen Gebilde der liberalen politischen Theorie in sich zusammenzufallen, weshalb sich der Liberalismus zweitens ideologischen Strategien der Selbstvergewisserung und Verteidigung zuwendet. Drittens konstruiert der Liberalismus ‚Regime der Tolerierung‘, 8 die jedoch eigenen theoretischen und politischen Grundprinzipien widersprechen und sich gewaltvoll gegen das Individuum wenden,9 beispielsweise durch Assimilation als Diktum und politische Strategie liberaler Einwanderungspolitik.10 Worum aber handelt es sich bei diesen Annahmen?
In der liberalen, analytisch betriebenen politischen Theorie (d.h. also hauptsächlich in der Rawlschen und Habermasschen Tradition) herrschen zwei erstrangige Annahmen vor. Beide gelten als unabänderlich, absolut und unumgänglich. Die erste ist die Annahme eines Urzustandes, aus welchem heraus der Philosoph, aber auch gewöhnliche Menschen, ihre Argumente formen;11 Beispiele hierfür sind die Annahme eines Naturzustandes in sozialkontraktualistischen Theorien oder, wie im Strukturellen Realismus, die Annahme von Anarchie als struktureller Vorgabe der internationalen Politik.12 Die zweite Annahme analytischer Theoriebildung setzt eine ideale Kommunikations- oder Handlungssituation mit rationalen, oder zumindest vernünftigen Akteuren voraus, woraus Typologien und Vorkehrungen für die Entstehung eines öffentlichen Diskurses sowie für politische Verhandlungen konstruiert werden. In beiden Fällen dieser hypothetischen – auf Annahmen beruhenden – Logik bestehen drei Probleme: (1) Diese Annahmen sind nicht empirisch. Das bedeutet, sie können richtig oder falsch sein – dies ist schlichtweg nicht klar – und dennoch sollen sie geteilt werden. Wer sie nicht teilt, wird ausgeschlossen (konzeptionell-theoretisch, wie auch in der aus diesen Annahmen hervorgehenden politischen Praxis) oder jegliche theoretische Konstruktionen fallen in sich zusammen. (2) Diese Annahmen neigen dazu, sich auf prozeduralistische Argumente zu stützen, die von ihrer Natur aus historische, gesellschaftliche und politische Gegebenheiten außer Acht lassen – das heißt, sie sind nicht kulturell differenziert. Und schließlich sind (3) alle theoretischen Schlussfolgerungen aufgrund ihrer Ignoranz empirischer Zusammenhänge artifiziell, weshalb liberale, analytisch vorgehende politische Theoretiker stets darum bemüht sind, empirische oder zumindest empirisch mögliche Fälle zu finden oder zu konstruieren, auf die ihre theoretischen Konstrukte zu passen scheinen.13
Hingegen scheint es jedoch ein im Wesentlichen empirisches Merkmal zu sein, das für die Konzeptualisierung des Verhältnisses zwischen ‚Selbst‘ und ‚Anderem‘ bzw. für die Konzeptualisierung von Identität grundlegend ist. Entsprechend der politischen Theorie des Liberalismus gilt es jedoch als vor-theoretisch und vor-empirisch gegebener ‚Urzustand‘, dass Menschen eine bestimmte Identität haben (etwa bestimmt durch ihre Ethnizität, Religion, Nationalität usw.), im Rawlschen und Habermasschen Sinne bestimmt durch ‚Vernunft‘, in deren Konsequenz dann die Unterscheidung zwischen ‚Selbst‘ und ‚Anderem‘ entsteht. Sowohl die Annahme, dass es eine Unterscheidung zwischen ‚Selbst‘ und ‚Anderem‘ gibt, als auch, dass Menschen über eine bestimmte Identität verfügen, werden ohne empirische Studien als allgemeingültig erachtet. Ähnlich unempirisch ist die Annahme, Identitäten – also ‚Selbst‘ und ‚Andere‘ – würden miteinander in Konflikt stehen. Die Anerkennung dessen sei ein ‚Urzustand‘, worin sich gleichsam Philosophen und gewöhnliche Menschen befänden. Ganz im Sinne dieser (weiterhin a-empirischen) Logik wird der angenommene Zusammenprall von Identitäten bzw. ‚Selbst‘ und ‚Anderem‘ typologisiert. ‚Lösungen‘ dafür werden aus ebenfalls mutmaßenden deliberativen Rationalitäten und in Anlehnung an die Institutionen des liberalen Staates geformt.14
Kenneth Waltz aus dem Bereich der internationalen Beziehungen bietet sich zur Illustrierung dieser Problematik wegen der Simplizität seiner Argumentation gut an. Im Sinne analytischer Sozialwissenschaft versucht Waltz, wissenschaftliche Theorien aus den Wirtschaftswissenschaften auf die Politikwissenschaft zu übertragen und führt dabei das Strukturelement ‚Anarchie‘ als Naturzustand zwischen Staaten für weiterführende Theoriebildung und die Analyse politischer Praxis ein. Wie er offen zugibt, ist diese Annahme weder historisch noch empirisch und erfüllt ihren Zweck lediglich aufgrund ihrer Nützlichkeit.15 Damit stellt sich zunächst folgende Frage: Was ist mit Nützlichkeit gemeint? Waltz gibt hierauf eine erste Antwort; eine zweite muss aus der ersten Antwort gefolgert werden. So ist eine Annahme nach Waltz erstens dann nützlich, wenn, beziehungsweise falls, sie weitere theoretische Debatten anregt, wenn sie also zur Bildung weiterer Abstraktionen und Typologien für und innerhalb desselben (analytischen) Paradigmas führt.
Diese sich selbst perpetuierende und permanente Produktion abstrakter (a-empirischer) und künstlicher Kategorisierungen, Typifizierungen und Konzeptualisierungen führt in eine theoretische Sackgasse, da die Kluft zwischen auf Annahmen basierenden Abstraktionen und praktischer politischer Erfahrung niemals zu überbrücken ist. Theorie kann daher als abstrakte und der politischen Praxis fernstehende intellektuelle Aufgabe nicht den normativen Rahmen für Politik bilden, der durch sie bereitgestellt werden soll; und immer dann, wenn ein Beispiel zu den gebildeten Kategorisierungen, Typifizierungen und Konzeptualisierungen zu passen scheint, taucht ein Gegenbeispiel auf, oft in Form eines weiteren theoretischen Konstrukts. Dieses permanente ‚Verrücken der Torpfosten‘16 steht metaphorisch für die theoretische Pattsituation analytischer Philosophie, welche, wie zuvor erwähnt, ihrer abstrakten und kontextunabhängigen Erkenntnistheorie entstammt. Diese Pattsituation scheint nur überwunden, wenn die zugrunde gelegten Annahmen als politische Konsequenzen verdinglicht werden, denn nur dann sind Theorie und Wirklichkeit vereinbar, allerdings nur um den Preis der Manipulation politischer Erfahrung. Diese Manipulation aber – und hier liegt die zweite Antwort auf die Frage der Nützlichkeit, die gleichzeitig auch den Bogen zum Problem der Toleranz/Tolerierung spannt – führt unweigerlich zu politischer Gewalt.17
Wie oben angedeutet, dient liberale Einwanderungspolitik hierfür als eindrückliches Beispiel. Das US-amerikanische Paradigma der Assimilation und das dazugehörige Diktum ‚E Pluribus Unum‘ haben die offizielle Einwanderungspolitik Amerikas für etwa 100 Jahre bestimmt und basieren sowohl auf Praktiken der ‚Tolerierung‘ als auch auf Geisteshaltungen der ‚Toleranz‘. Differenz(en) werden hierbei vom Selbstbild der eigenen Gesellschaft ausgehend formuliert und fixiert. Somit ziehen liberale Staaten die praktischen und normativen Grenzen der Tolerierung/Toleranz nach den Institutionen und Gepflogenheiten der eigenen Gesellschaft. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass (1) diese Staaten von ‚Einwanderern‘ erwarten, dass sich diese in die eigene Gesellschaft kulturell eingliedern und anpassen oder (2) erstens Einwanderung dahingehend reguliert wird, dass a priori entschieden wird, welche Gruppen zur Assimilation fähig oder unfähig sind und, daraus folgend, zweitens deren Einwanderung schließlich eingeschränkt bzw. verboten und ihre Kulturen als ‚fremd‘ und ‚andersartig‘ stigmatisiert werden. Eine Reihe empirischer Studien zeigt, dass solche vorgeformten Entscheidungen und Stigmatisierungen auf ethnischen, religiösen und biologischen Argumenten basieren. Die politische Praxis liberaler Staaten widerspricht damit eigenen (selbst auferlegten) liberalen Paradigmen der strikten Trennung von ‚Ethnos‘ und ‚Demos‘ und der Neutralität in Identitätsfragen. Über die Vereinigten Staaten hinaus findet sich dieser Widerspruch auch in der Einwanderungspolitik Großbritanniens, Frankreichs oder Deutschlands wieder, wenn auch in unterschiedlich starken Ausprägungen. Dieser Selbstwiderspruch und die Verletzung dieser grundlegenden Prinzipien ist, neben politischen Praktiken, auch charakteristisch für (anscheinend) liberal-republikanische Autoren wie Jean-Jacques Rousseau, Ernest Renan, Johann Gottfried Herder, John Locke oder Schriften wie die Federalist Papers usw., deren ideengeschichtliche Reputation gerade (jedoch fälschlicherweise) daher rührt, einen republikanischen Volkskörper ohne Berufung auf ethnische Kriterien visioniert zu haben. Eine gründliche und kritische Lektüre ihrer Schriften lehrt uns jedoch das Gegenteil, nämlich eine feste Verankerung primordialer Vorstellungen von Volk, Staat und Nation in ihren politischen Theorien.18