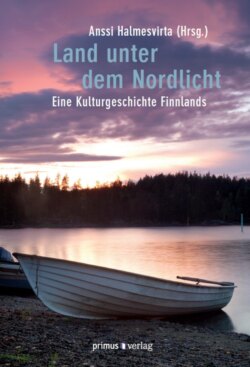Читать книгу Land unter dem Nordlicht - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Finnland christianisiert sich
ОглавлениеDie mittelalterliche katholische Kirche und die adelig geprägte, schwedische Chroniküberlieferung berichten, dass Finnland während dreier Kreuzzüge christianisiert wurde, die zwischen 1150 und 1293 von Schweden aus in verschiedene Teile Finnlands unternommen wurden: an die Südwestküste, nach Häme und nach Karelien. Der Kreuzzugsbegriff wurde der allgemeineuropäischen Rhetorik von der Schwertmission entlehnt. Der geschilderte, wenngleich geringfügige Konnex zwischen der Christianisierung und den Kreuzzügen beherrschte lange Zeit auch die Interpretation in der finnischen und schwedischen Geschichtsschreibung. Seitdem ist die Bedeutung der in Missionsabsicht geführten Kreuzzüge in der Forschung umstritten. Über den Zeitpunkt des zweiten Kreuzzuges besteht noch immer keine einhellige Meinung und auch die historischen Tatsachen des ersten Kreuzzuges wurden angezweifelt. An der Wende zum 13. Jahrhundert hatte das schwedische Reich jedenfalls seinen Zugriff auf Finnland so weit gefestigt, dass vor allem an den Küsten und auf den Inseln schwedische Niederlassungen gegründet werden konnten, die ihrerseits den Christianisierungsprozess stärkten.
Nach neueren Auffassungen haben aber keineswegs die Kreuzzüge die Christianisierung der Frühfinnen eingeleitet, sondern diese hat schon in noch früheren Jahrhunderten begonnen. Archäologische Funde zeugen einerseits von sehr frühem christlichem Glauben auf der finnischen Halbinsel, andererseits von langfristig anhaltendem Heidentum. Entscheidend dürfte hier die Einsicht sein, dass unterschiedliche religiöse Ansichten wohl kaum gleichzeitig in gleicher Stärke die Menschen eines bestimmten Zeitraumes durchdringen und dass diese sich auch nur höchst selten ganz plötzlich verändern. Dies gilt nicht nur für die Christianisierung Finnlands, sondern ebenso beispielsweise für die Reformation, deren Realisierung sich auch über die Lebenszeit mehrerer Generationen hinzog.
Die frühesten in Finnland aufgefundenen Objekte, die auf das Christentum verweisen oder in diesem Sinne interpretierbar sind, stammen aus dem 4. bis 6. Jahrhundert. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um außerhalb Finnlands gefertigte Kultgegenstände, die auf diese oder jene Weise bis in den fernen Norden gelangten. Es ist allerdings unsicher, was die Träger eines solchen christlichen Gegenstandes, zum Beispiel eines Kruzifixes, selbst darüber gedacht haben. Es konnte wohl auch in übertragenem Sinne als heidnischer Zaubergegenstand oder vielleicht einfach als Schmuckstück gedient haben. Im Ganzen gesehen blieb Finnland lange ein heidnisches Land, zumindest wenn man die dortige Situation mit dem übrigen Europa und den umliegenden Ländern vergleicht, die wenigstens formell schon zu Beginn des 11. Jahrhunderts christianisiert wurden.
Wegen weithin fehlender schriftlicher Quellen gab es höchst unterschiedliche Meinungen zur Herkunftsrichtung und Ausbreitung des Christentums. Der Norden war juristisch zunächst Missionsgebiet des Erzbistums Hamburg-Bremen, bis in Lund, Nidaros (Trondheim) und Uppsala im 12. Jahrhundert Erzbischofssitze gegründet wurden. Im nahe gelegenen Osten wurde der Nowgoroder orthodoxe Erzbischofssitz 1165 gegründet. Von den Forschern wurden nun widersprüchliche Ansichten über die Formen und die Bedeutung der westlichen und östlichen Missionsarbeit vorgelegt. Einige Wissenschaftler sahen in den auf finnischem Boden gefundenen christlichen Gegenständen und auf christliche Grundlage zurückgehenden Lehnwörtern etwa Einflüsse keltischer Missionsprediger, die von den Britischen Inseln hergekommen waren. Auch den Bernhardinermönchen wurde die Rolle frühzeitiger Bekehrer der Finnen zugeschrieben, obgleich bekanntlich auf der finnischen Halbinsel – im Gegensatz zu Schweden – kein einziges Kloster des Zisterzienserordens je errichtet wurde.
Schwertmission und Gründung von Niederlassungen versuchten neben den Schweden auch die Dänen, die im Norden Estlands operierten und an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert mindestens einen Kreuzzug in die westlichen Regionen Finnlands unternahmen, vielleicht sogar zwei oder drei. Die Russen waren also nicht die Einzigen, mit denen die schwedischen Könige und Adligen bei der Machtergreifung in den finnischen Gebieten konkurrierten. Ein dänisches Itinerar, ein Reiseführer also, bildet Segelrouten ab, die an der finnischen Südküste entlang nach Tallinn (Reval) führten. Die Inselwelt und die Küste Finnlands weisen noch immer Ortsnamen auf, die auf dänische Kultur und möglicherweise auch Niederlassung hindeuten. Der finnische Name der Stadt Porvoo in der Provinz Uusimaa etwa könnte dänische Aussprache widerspiegeln, weil der schwedische Name Borgå eher die Form Porkoo voraussetzt, denn es ist denkbar, dass die Burg, die der Stadt den Namen verliehen hat, von Dänen erbaut wurde oder sich doch am Übergang vom 12. zum 13. Jahrhundert in dänischem Besitz befand. Einige Untersuchungen wollen auch dänische Einflüsse im Heiligkreuzkult nachweisen, der in Häme vorgefunden wurde, weil die Dänen diesen auch in Estland verbreiteten. Die Kirche des in Häme liegenden Ortes Hattula war das berühmteste dem Heiligen Kreuz geweihte Bauwerk und diente als Wallfahrtsort auch für Dänen. Als Schweden und Dänen im späten Mittelalter gegeneinander um die Herrschaft in Finnland kämpften, führten dänische Piraten Raubzüge an den finnischen Küsten und auch in der Stadt Turku durch, was im Bewusstsein des Volkes Angst und Hass gegen die „Juten“ und „Danen“ hinterließ.
Am allermeisten wurde bezüglich des finnischen Christianisierungsprozesses über das Ausmaß der ostkirchlichen Beteiligung an der Missionsarbeit diskutiert. Einige Forscher glauben, dass sich der christliche Glaube in der ersten Phase von Osten her nach Finnland ausbreitete und auch den Südwesten erreichte. Dies bezeugt der Wortschatz christlichen Inhalts in der finnischen Sprache eindrücklich: So sind zum Beispiel die finnischen Wörter pappi (Pfaffe, Priester), risti (Kreuz), Raamattu (Bibel) und kummi (Pate) aus slawischen Sprachen oder aus dem Griechischen beziehungsweise über das Slawische aus dem Griechischen entlehnt. Dieser christliche Grundwortschatz scheint sich so fest im Finnischen (richtiger in dessen Mundarten) verwurzelt zu haben, dass er keine Veränderung mehr erfuhr, als Skandinavier und aus dem übrigen Europa angekommene Missionare den Christenglauben in seiner katholischen Variante verbreiteten.
Die Burg in Hämeenlinna
Die Burg auf einer Postkarte aus dem Anfang des 20. Jhs. (links) und als historisches Denkmal mittelalterlicher Befestigungen restauriert (rechts). Sie diente Ende des 13. Jhs. zunächst als Lager der östlichsten Grenzbefestigung Schwedens, wurde aber mit den Grenzverschiebungen nach Osten zum Wohnschloss des Burgherrn ausgebaut. Im 18. Jh. wurde ein drittes Geschoss hinzugefügt und eine Ringmauer errichtet. 1837–1972 war in dem Gebäude ein Gefängnis untergebracht. Nach fertiggestellter Restaurierung wurde die Burg Besuchern zugänglich gemacht.
Die östliche Missionsarbeit kann man vielleicht für das 10. und 11. Jahrhundert ansetzen. Nach der chronikalischen Überlieferung schickte der Großfürst von Kiew, Wladimir, der sich als erster russischer Herrscher 988 zum Christentum bekannte, Priester und Mönche auch nach Finnland und Karelien, um den christlichen Glauben bis an die Grenzen seines Machtbereichs auszudehnen. Außer dem Wortschatz dürften zahlreiche alte slawische Familiennamen an diese früheste orthodoxe Missionierung erinnern, ebenso wie möglicherweise der Ortsname Turku und der Name des vorher am gleichen Ort gelegenen Marktplatzes Koroinen; Ersteren kann man mit dem slawischen Wort für tori (Marktplatz) in Verbindung bringen, Letzteren mit dem slawischen Wort für kaupunki (Stadt). Es ist möglich, dass die Russen nicht die einzigen Slawen waren, mit denen die eisenzeitlichen Finnen auf ihrem Boden zu tun hatten: Slawische Einflüsse könnten auch auf die an den Südküsten der Ostsee wohnenden und mit Segelschiffen Handelsfahrten unternehmenden Venden zurückzuführen sein, die mit dem finnischen Wort venäläinen (Russe, russisch) vielleicht ursprünglich gemeint waren.
Es halten allerdings nicht alle Forscher den östlichen und den slawischen Einfluss für so erheblich. Die Etymologie der Ortsnamen Turku und Koroinen lässt sich auch auf viele andere Weisen erklären. Außerdem ist festzuhalten, dass in Südwestfinnland nur sehr wenige auf russischen Ursprung verweisende Fundgegenstände aufgetaucht sind. Des Weiteren ist auffällig, dass Karelien langsamer christianisiert wurde als die westlichen Gegenden Finnlands, was wiederum eine primär katholische Missionierung nahelegt. Auch die etymologische Bedeutung der Lehnwörter als Ausdruck der Herkunft christlicher Einflüsse ist bestritten worden. Infolge der katholischen Missionierung wurden aus dem Westen mehrere zentrale christliche Begriffe ins Finnische übernommen, wie etwa kirkko (Kirche) und alttari (Altar). Hingegen ist bemerkenswert, dass das finnische Wort pappi (Pfaffe, Priester) keine Entsprechung in den skandinavischen Sprachen hat, obgleich das Christentum in seiner katholischen Ausprägung in Finnland letztlich vor allem von Schweden her Verbreitung erfuhr, während einiger Jahrzehnte offensichtlich auch aus Dänemark. Das deutet darauf hin, dass der Pfaffenbegriff und die Gruppe der Priester schon gebildet und im Bewusstsein der Altfinnen verwurzelt waren. Auch die die Christianisierung betreffende mittelalterliche Überlieferung stützt die Auffassung von der frühzeitigen Gegenwart russischer Herrschaft und orthodoxen Glaubens: Bei der Schilderung des Kreuzzuges nach Häme konstatiert die im 14. Jahrhundert abgefasste Erikschronik, dieser schwedische Kriegszug habe zur Folge gehabt, „dass der russische König viel Land verlor“, und als Sebastian Münster in seiner 1544 verfassten Cosmographia Finnland behandelt, berichtet er über den vor langer Zeit erfolgten Kirchenwechsel. Münsters Ausführungen müssen auf dem am Ende des Mittelalters vorherrschenden Kenntnisstand und einer entsprechenden Überlieferung zur orthodoxen Zwischenphase in Finnland beruhen.
Wesentlicher als das Problem, auf welchen Wegen sich das Christentum in der finnischen Gesellschaft ausbreitete, ist jedoch die Frage, was die christliche Kultur beinhaltete und wodurch sich eine Person, die sich zu ihr bekannte, von den Heiden unterschied. Diese Frage ist schon deshalb wichtig, weil während des Jahrhunderte andauernden Christianisierungsprozesses christianisierte und heidnische Menschen Nachbarn waren. Letztendlich blieben die Heiden in der Minderheit. Immerhin waren sich Christen und Heiden während der langen Übergangszeit der Bräuche und Glaubensvorstellungen der jeweils anderen bewusst. Es ist nicht bekannt, ob sie an den Ritualen der Andersgläubigen teilnahmen oder ob sich Grenzzonen zwischen den Glaubensgemeinschaften bildeten, die eine solche Wechselwirkung verhinderten. Aus den archäologischen Untersuchungen geht weder hervor, ob zwischen heidnischen und christianisierten Finnen Feindlichkeiten bestanden, noch gibt es Anzeichen dafür, dass es zu Unterbrechungen des Warenaustauschs zwischen den Gebieten gekommen ist. Wohl werden in einer Kreuzzugsbulle Papst Gregors IX. aus dem Jahre 1237 die „abtrünnigen“ Hämebewohner erwähnt, die zum Heidentum abgefallen waren und begonnen hatten, Christen zu verfolgen, aber die dramatischen Formulierungen des Papstes scheinen aus anderen, auf die Vernichtung der Heiden abzielenden Schriften übernommen zu sein, sodass man sie nicht wirklich als Beleg für Gewalttätigkeiten werten kann, die unter Finnen im Mittelalter vorgekommen wären.
Wegen des Fehlens von auf das Individuum bezogenen schriftlichen Quellen lassen sich über die Glaubensüberzeugung des Einzelnen und sein Verständnis der christlichen Lehre keine Aussagen machen. Es lassen sich jedoch Schlüsse und Annahmen aus mentalitätshistorischen Strukturen ableiten, indem man Kenntnisse zur Verhaltenskultur und materiellen Kultur verschiedener Religionsgruppen analysiert. So konnte entgegen der offiziellen Lehrmeinung, wonach die heidnischen Bräuche als Teufelsverehrung anzusehen waren, der christliche Glaube auch angenommen werden, ohne völlig auf die alten Vorstellungen und Praktiken verzichten zu müssen. In ihrem Missionsgebiet akzeptierte die Kirche praktisch die sogenannte Primsignation, womit die Entscheidung des Einzelnen gemeint ist, Bedeutung und Kraft des Kreuzes anzuerkennen, sich aber nicht unbedingt taufen zu lassen. Nach Ansicht der Kirche löste sich der Bekehrte durch die Primsignation vom Heidentum. Für viele Betroffene dürfte es sich schlicht um eine sinnvolle Vorgehensweise gehandelt haben, um sich die Möglichkeit zu erhalten, in christianisierten Gegenden Handel zu treiben oder nominell in die Dienste des christlichen Herrschers zu treten. Die Bedeutung der Taufe sollte ebenfalls nicht überschätzt werden, auch wenn sie auf persönlicher Ebene sicher eine wichtige Erfahrung gewesen sein mag. Oben wurde bereits die Verärgerung der katholischen Kirche hinsichtlich der wenig ausgeprägten ernsthaften Bekehrungsbereitschaft der Einwohner von Häme angesprochen; entsprechende Hinweise gibt es auch zu früheren Jahrzehnten der Kreuzzugszeit. 1171 oder 1172 beklagt Alexander III. in einer Bulle, dass die Finnen im Moment drohender feindlicher Gefahr bereitwillig als Christen auftreten, sich aber vom christlichen Glauben distanzieren, sobald die Gefahr vorbei ist. In einer Bulle von Papst Innozenz III. wird der Eigensinn der Finnen in gleicher Weise beanstandet.
Trotz des negativen päpstlichen Urteils hatte sich das Christentum oder wenigstens die christlich gefärbte religiöse Brauchtumskultur im 12. und 13. Jahrhundert in vielen finnischen Dörfern schon durchgesetzt, obwohl heidnische Gepflogenheiten noch immer geübt wurden. Eine der bedeutendsten mit dem Christenglauben einhergehenden Veränderungen betraf die Bestattungskultur. Man hat deshalb auch versucht, Erkenntnisse über die Ausbreitung der christlichen Religion anhand dessen zu gewinnen, wann und wo die Einäscherung durch das Begräbnis des Leichnams abgelöst wurde. Auch in diesem Zusammenhang sind Zeichen einer Übergangszeit festzustellen: Anfangs wurden nicht eingeäscherte Körper an den Plätzen für die Feuerbestattung beigesetzt, bis dafür eigene Friedhöfe angelegt waren. Den Verstorbenen gab man oft auch Gegenstände mit ins Grab, wahrscheinlich damit diese sie im Jenseits nutzen konnten. Auch in Frauengräbern wurden Waffen gefunden, zum Beispiel Schwerter. Manchmal wurden den Toten auch im Ausland geprägte Münzen mitgegeben.
Man hat versucht, die Grabstätten je nach Himmelsrichtung, in der sie angelegt sind, als christlich oder heidnisch zu bestimmen. Es sind aber keineswegs alle in Ost-West-Richtung errichteten Gräber christlich gewesen, was daraus hervorgeht, dass zahlreiche Beisetzungen sowohl christliche als auch heidnische Zeichen aufweisen. Gruben, die keine oder nur sehr wenige Gegenstände enthielten, etwa wenn dem Verstorbenen lediglich ein Gürtel und ein Messer oder vielleicht eine Kreuzkette beigelegt waren, sind eindeutiger als christlich zu interpretieren. Die frühesten Gräber dieser Art stammen aus dem sogenannten Vakka-Suomi („Schachtel-Finnland“) an der finnischen Westküste. Etwas weiter südlich, in der Gegend, die das geistliche und weltliche Zentrum des katholischen Finnland darstellte, wurden den Gräbern in vielen Dörfern noch im 12. Jahrhundert gegenständliche Gaben beigefügt. Dennoch kann man das 12. und 13. Jahrhundert als Epoche der Durchsetzung christlicher Begräbnistraditionen bezeichnen.
Ein anderer wichtiger Unterschied mit Blick auf die religiösen Rituale betrifft den Platz, wo sie durchgeführt wurden. Im heidnischen Glauben vollzog man die Riten meistens im Freien, Gebäudereste heidnischer Kultstätten gibt es nicht. Wohl konnten religiöse Handlungen in Einzelfällen auch im Hausinneren stattfinden, aber schon ein Ritual, an dem das ganze Dorf teilnahm, setzte mehr Raum voraus, der nur im Freien zur Verfügung stand. Die Situation dürfte in anderen skandinavisch-heidnischen Glaubensgebieten ähnlich gewesen sein. Frühschwedische Glaubensrituale beispielsweise fanden in Hainen und an besonderen Felssteinen statt, wie man den Formulierungen im Gesetz der Provinz Uppland entnehmen kann, die derartige heidnische Handlungen ausdrücklich verbieten.
Der christliche Glaube konzentrierte geistliche Rituale in erster Linie in eigens dafür gebauten Räumlichkeiten unter der Anleitung Geistlicher. Das Kircheninterieur war zwar von Menschen errichtet, aber es konnten nach damals schon Jahrtausende alter Tradition überirdisch wirkende Elemente wie Heiligenbilder, Wechsel von Licht und Schatten, Weihrauchduft und Kirchenlieder eingebunden sein. Alle diese Elemente hatte man gelernt effektiver einzusetzen als unter freiem Himmel, und in Innenräumen klangen die durch Echoeffekte verstärkten Kirchenlieder ganz anders als draußen im Freien. Die Kirche wusste also schon als Erlebnisraum durchaus mit dem Heidenglauben um die Gunst der Menschen zu konkurrieren. Außerdem fungierte der kirchliche Bau als sichtbares Symbol des neuen Glaubens und seiner Macht.
Früher glaubte man, viele der finnischen Steinkirchen seien schon zur Kreuzzugszeit errichtet worden, aber neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten doch jüngeren Alters sind. Kirchen wurden lange Zeit aus Holz gebaut, da der Bau so schneller voranging und preisgünstiger war; die Finnen hatten auch keine Erfahrungen mit Steinbauten. Die ersten finnischen Steinkirchen wurden auf den Ålandinseln errichtet, und auch dort erst in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts. Auf dem Festland entstanden die ersten Steinkirchen an der Südwest- und Südküste ab 1420. Die Heiligkreuzkirche von Hattula in Häme war die erste und einzige Kirche aus Stein, die vor dem Ende des 15. Jahrhunderts im Binnenland gebaut wurde. Die anderen im Landesinneren und im Norden errichteten alten Steinkirchen stammen erst aus der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die ältesten dürften sicher auf Plänen norddeutscher Fachleute beruhen. Auch die Kultobjekte für die Innenausstattung wurden teilweise von ausländischen Künstlern hergestellt und im 15. Jahrhundert wurden die in Mode gekommenen dreiteiligen Altäre mit ihren Malereien und ihrem Schnitzwerk sogar aus Flandern und Norddeutschland bestellt. Aber auch einheimische Handwerker begannen nun, Kirchen auszumalen und Heiligenfiguren anzufertigen.
Bei der Gründung und Errichtung von Kirchen lassen sich noch andere Faktoren als Holz- und Steinbau oder verschiedene Stilrichtungen unterscheiden. Am Ort der zur Kreuzzugszeit christianisierten Grabstätten und der in den Besitz der Kirche übernommenen oder erhaltenen Opferhaine, oder zumindest in deren Nähe, gründete man Dorfkirchen und Kapellen, die nicht unbedingt einen eigenen festen Pfarrer hatten. Die Errichtung solcher Gotteshäuser zeugt von der Christianisierung auf lokaler Ebene, ist jedoch nicht unbedingt Ausdruck der religiösen Überzeugung ihrer Erbauer; vielmehr war die Unterhaltung einer „eigenen“ Kirche eher dazu angetan, den Wohlstand lokaler Herren und der Region auszudrücken. An der Westküste des Bottnischen Meerbusens bezeugten angesehene Männer und Frauen ihren Glauben und ihren Rang oft auch in Form von Runensteinen, in die christliche Symbole eingeritzt wurden, aber diese Tradition dürfte den Finnen weithin fremd geblieben sein.
Etwa zur gleichen Zeit, als die katholische Kirche ihren Zugriff auf die westlichen Teile Finnlands festigte und sich hier die kirchliche Hierarchie etablierte, organisierte auch die schwedische Obrigkeit die Verhältnisse entsprechend den Verwaltungsgepflogenheiten im Mutterland. Die entstandenen Gemeinden erhielten ihre Mutterkirche, die oft keine alte Dorfkirche oder Kapelle war, sondern an einem ganz neuen Platz gebaut wurde. Die Kirche institutionalisierte sich und begann sich von der Lebenswelt der Laien zu distanzieren, wenn auch der Unterschied zwischen Pfaffen und Bauern nicht übertrieben werden darf, zumindest nicht in abgelegenen Gegenden. Noch gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte die finnische Kirche hinreichend damit zu tun, die Geistlichen an die Einhaltung der Zölibatspflicht zu gemahnen und die unehelichen Kinder der Priester aus den Pfarrhäusern zu vertreiben.
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts zählte die finnische Halbinsel 40 katholische Gemeinden, bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts erhöhte sich ihre Zahl auf etwa 100. Das früheste geistliche Zentrum des Katholizismus in Finnland war die Kirche zu Nousiainen, wo die Gebeine des Märtyrerbischofs Henrik aufbewahrt wurden, der am ersten Kreuzzug teilgenommen hatte. Nousiainen war offensichtlich der Stützpunkt des Bischofs Henrik gewesen, während er die kirchlichen Verhältnisse in den südwestlichen Gebieten ordnete. Nousiainen lag freilich im Landesinneren und die Verbindung zur Außenwelt ließ sich besser an den Küsten und Flussmündungen aufrechterhalten. Deshalb wurde der Bischofssitz näher ans Meer nach Koroinen verlegt, das am Fluss Aura lag und wo sich schon ein internationaler Marktplatz mit fester Besiedlung gebildet hatte. Die Verlegung erfolgte wahrscheinlich im Jahre 1229 oder Anfang der 30er Jahre. Manche Forscher haben den Umzug mit der päpstlichen Bulle von 1237 in Verbindung gebracht, in der das Heidentum und die Grausamkeiten der Bewohner von Häme verurteilt werden; sie wollten darin eine Antwort auf die heidnische Reaktion sehen. Nach dieser Interpretation war Koroinen für den Bischof ein sichererer Ort als Nousiainen.
Im 13. Jahrhundert begannen auch die Dominikaner und die Franziskaner ihre Predigttätigkeit in Finnland und an dem alten Ostweg entlang der südlichen Inseln. Die Dominikaner gründeten Konvente in Turku und in Wiborg, die Franziskaner in Rauma, Wiborg und an der alten Seeroute in Kökar auf den Inseln vor Turku. Das einzige katholische Nonnenkloster erhielt Finnland erst um 1440, als in Naantali ein Birgittenkloster seine Arbeit aufnahm. Es gibt Anzeichen dafür, dass in Turku bereits ein dominikanisches Nonnenkloster in Gründung befindlich war, das in das neue Birgittenkloster integriert wurde. Aus dem Briefwechsel der Nonnen geht hervor, dass das Kloster in Naantali mit den Dominikanerbrüdern um Schenkungen konkurrierte.
Henriks Sarkophag in Nousiainen
Der erste Kreuzzug nach Finnland ist an der Seite des Sarkophags vom heiligen Henrik in der Kirche zu Nousiainen abgebildet. Der um 1415–1420 angefertigte Sarkophag ist mit wahrscheinlich aus Flandern stammenden Messingplatten versehen. Die Gravierungen der Details von Bekleidung und Waffen folgen dem internationalen Stil vom Anfang des 15. Jhs. Die Deckplatte zeigt Bischof Henrik und unter seinen Füßen eine kleine menschliche Figur, seinen Mörder Lalli aus Köyliö. Vor dem Bischof kniet Bischof Magnus II. Tavast. Das große Bildfeld wird von einem Ausschnitt aus der Liturgie des heiligen Henrik in lateinischer Sprache umrahmt. Die Ecken der Randleiste zieren Symbole der Evangelisten, in der Mitte unterbrechen den Textstreifen die Wappen der Domkirche zu Turku und des Geschlechts der Tawast. Die Seitenplatte des Sarkophags, hier im Bild, schmücken Lebensphasen des heiligen Henrik vom Kreuzzug bis zu seinem Märtyrertod sowie einige Wundertaten des Heiligen.
Der südlich von Koroinen in der Nähe des Handelsplatzes Turku 1249 gegründete Dominikanerkonvent und die stetig zunehmende deutsche Handelsbevölkerung ließen Turku zur Stadt anwachsen, die Koroinen an Bedeutung überflügelte, da sie näher an der Auramündung lag. Im Jahr 1270 begann der Bischof von Finnland, sich selbst Bischof von Turku zu nennen, obwohl die Domkirche sich noch immer in Koroinen befand. Das finnische Missionsbistum bildete sich jedoch zur Diözese Turku aus und die Kirche wurde in das neue Zentrum verlegt. Der Dom zu Turku wurde im Jahre 1300 eingeweiht. Die Bischöfe selbst wohnten freilich noch bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts weiterhin in Koroinen.
Die weltliche Obrigkeit errichtete in der Nähe zum Schutze der Stadt eine Burg, deren Existenz allerdings nicht verhindern konnte, dass die Russen 1318 sowohl die Stadt als auch die Domkirche plünderten. Auch später litt Turku unter Raubzügen aus verschiedenen Richtungen. Trotzdem wurden um die Stadt nie Verteidigungsanlagen errichtet. Die einzige finnische Stadt, die im Mittelalter von einer Mauer umgeben wurde, war Wiborg. Die Bischöfe von Turku bauten zu ihrer Sicherheit außerhalb der Stadt an der Meeresküste die Burg Kuusisto.
Die von der orthodoxen Kirche im mittelalterlichen Karelien aufgebaute kirchliche Organisation ist weit weniger bekannt. Eine eigene Diözese gab es hier für kurze Zeit nur 1589 in Käkisalmi. Die karelischen orthodoxen Gebiete kontrollierte im Mittelalter der Erzbischof von Nowgorod, der allerdings spätestens im 15. Jahrhundert in Korela, also Käkisalmi, einen Stellvertreter einsetzte. Anders als in den katholischen Gegenden der finnischen Halbinsel wurden im orthodoxen Karelien zahlreiche Klöster gegründet, die teilweise allerdings recht klein waren. Zum bekanntesten und wichtigsten stieg das auf der Insel Valamo im Ladogasee gelegene Kloster auf, über dessen Gründungszeit äußerst unterschiedliche Auffassungen bestehen. Zahlreiche seiner Mönche verrichteten Missionsarbeit in Karelien.
Selbst aus den Gemeinden im weit entfernten Finnland wurden Problemfälle direkt an den Papst herangetragen. So verfuhr etwa der Gemeindepfarrer von Sääksmäki, Henrik Hartmanninpoika, als sich 25 Bauern weigerten, der Kirche den Zehnten zu zahlen. Er belegte die Aufmüpfigen mit dem Kirchenbann und Geldstrafen, die weiter anwuchsen, wenn die Betreffenden die Zahlung des Zehnten hinauszögerten. Auf Bitte des Pfarrherrn bestätigte Papst Benedikt XII. die Strafen in einer Bulle von 1340 als kirchenrechtlich relevant. Da die Bulle die Namen der widerspenstigen Bauern auflistet, lässt sich ersehen, dass der größte Teil von ihnen heidnische finnische Namen trug, wenn auch vereinzelt Namen christlicher Prägung darunter waren. Höchst interessant ist dabei, dass zweimal der Name Suomalainen (Finne) auftaucht: Wurde den Männern dieser Name von ihren Familien als kulturelle Stellungnahme in einer Situation verliehen, da die neue Macht und Kultur in Häme Einfluss gewann? Obschon auch diese Frage offen bleibt, beleuchtet die Bannbulle doch außer dem Widerstand gegen das kirchliche Besteuerungsrecht auch das starke Vorhandensein frühfinnischer Kultur im Binnenland noch fast um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Es ist durchaus möglich, dass noch nicht einmal alle der aufständischen Bauern überhaupt getauft waren.
Die Kirche versuchte auf vielerlei Weise, die Finnen für sich zu gewinnen: durch die Verkündigung des Evangeliums, mithilfe der Unterstützung der weltlichen Obrigkeit oder auch durch die ihr selbst zugewachsene Autorität. In der Zeit der Christianisierung nutzte man gerne die Erinnerung an den Märtyrerbischof Henrik. In vielen Dorfkirchen diente dem Kirchenvolk eine Statue zur Anschauung, die Bischof Henrik zeigt, wie er seinen Mörder mit Füßen tritt. Die überweltliche Macht der Kirche wurde so auch denen bildlich vor Augen geführt, die sonst von ihrer Botschaft nichts verstanden oder ihr gleichgültig gegenüberstanden. Der Märtyrertod Henriks und die Bestrafung seines Mörders interessierten das Volk offensichtlich, wie man aus der Fülle der Erzähltradition zu diesem Thema schließen kann. Die Volksdichtung nannte den Heiden, der den Bischof umgebracht hatte, Lalli (auch Lallo oder Lalle). Erzählt wird, wie Lalli letztlich seiner Bestrafung nicht entging: Als er den Bischofshut aufprobierte und wieder abnahm, verlor er dabei seine Haare und die Kopfhaut, danach bedrängten ihn Mäuse, sodass er in einen See flüchtete und ertrank. Wenngleich manche dieser Dichtungen und Geschichten über Lalli erst im 19. Jahrhundert verschriftlicht wurden, lässt sich daraus doch die mittelalterliche Urform ableiten. Es ist anzunehmen, dass die katholische Geistlichkeit die Verbreitung der Geschichten über Lalli förderte, um damit ihr eigenes Ansehen zu stützen.