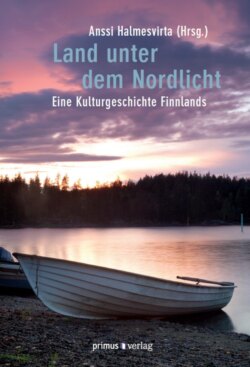Читать книгу Land unter dem Nordlicht - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеDas vorliegende Werk ist die erste einbändige, speziell für ausländische Leser konzipierte Kulturgeschichte Finnlands, verfasst von Forschern am Institut für Geschichte und Ethnologie der Universität Jyväskylä. Motivation dafür – und für die Übersetzung ins Deutsche – war das wachsende Interesse an der im deutschsprachigen Raum noch immer als exotisch empfundenen „reinen“ Natur in Finnland und Lappland. Das 1998 erschienene Kulturlexikon Finnland reicht nicht aus, dieses Interesse zu befriedigen, geschweige denn ein umfassendes Bild von der Entwicklung der finnischen Kultur seit der Vorhistorie bis in die Gegenwart zu liefern. Dies zeigt sich unter anderem auch in der fortwährenden Zunahme der Mitgliederzahl der Deutsch-Finnischen Gesellschaft in Deutschland, die inzwischen über 10.000 beträgt und damit den zweitgrößten Freundschaftsverein in Deutschland bildet.
In verschiedenen Aspekten ist die finnische Kultur durchaus in Deutschland bekannt geworden. Das bezeugt der bis ins Mittelalter zurückgehende, anhaltende Kulturaustausch, dessen letzte Phasen in dem Buch Finnland und Deutschland im 20. Jahrhundert (1999) beschrieben sind. Und das Bekanntwerden mit Finnland hat sich bei den Deutschen in letzter Zeit nur noch vertieft. „Ich liebe dieses Land“, seufzt der Bachtin-Forscher an der Universität Toronto, der Philosoph Wolfram Eilenberger, und er meint damit nicht nur seine finnische Frau, sondern auch so fundamentale Ausprägungen der finnischen Kultur wie Sauna, hausgebrautes Bier (sahti), Elchfeste nach der Jagd, Wurstgrillerei und Wettkämpfe im Weibertragen. Er steht dem Finnentum nicht so lakonisch gegenüber wie der Schriftsteller Roman Schatz (Suomesta, rakkaudella – From Finland with Love, 2005): „Ich würde nun nicht ganz so weit gehen, Finnland als Paradies zu bezeichnen. Dazu ist es, verdammt nochmal, viel zu teuer und zu kalt.“ Eilenberger bleibt in seinem Buch Finnen von Sinnen. Von einem, der auszog, eine finnische Frau zu heiraten (2010, finn. 2011 als Minun suomalainen vaimoni, „Meine finnische Frau“) den Finnen gegenüber jovial, wenn er mit frotzelndem Humor deren Lebensweise glossiert – genau genommen möchte auch er fünf Monate im Jahr wie ein Muminpapa in einem Sommerhäuschen leben, seine Memoiren schreiben und seine Kinder zu Kosmopoliten erziehen. Er ist wie der zum Tode verurteilte deutsche Gefangene, der auf die Frage nach seinem letzten Wunsch antwortet: „Ich möchte Finnisch lernen.“
Das Gefühl der Nähe war zwischen Deutschland und Finnland immer vorhanden. In finnischen Kulturkreisen gab es stets viele Deutschlandfreunde; in deutschen Landen wiederum haben bestimmte finnische Subkulturerscheinungen sogar eher Verständnis gefunden als im Heimatland. Als der Avantgarde-Musiker M.A. Numminen in Berlin den Tractatus von Wittgenstein auf Deutsch sang, wurde er sofort zum Liebling der intellektuellen Underground-Szene. In Ostdeutschland durfte er freilich nicht auftreten, denn er war ja populär in den linken Klubs Westdeutschlands. Seine bewusst missklingend kreischende Stimme machte ihn zum skurrilen „schrillen Numminen“, seine Lieder haben aber später den Weg auch in „höhere“ Kulturkreise gefunden.
Dieses Buch entfaltet sich aus zwei Hauptthemen, die auf der Auffassung beruhen, dass Kultur sozial fundiert ist und in der Gesellschaft bewusst oder unbewusst als Wissen, Erfahrung und in Handlungsmodellen verbreitet wird. Es werden zum einen die typischen Züge der Hoch- oder Elitekultur wie der Volkskultur in ihrem Verhältnis zueinander und im Wandel der Kulturströmungen in verschiedenen Epochen behandelt, wobei sich zeitweise eine einseitige Dominanz des gesamten Kulturfeldes durch die Hochkultur abzeichnet, dann wieder in deren Wechselwirkung mit der Volkskultur fast eine Symbiose oder aber die Nachahmung der Elitekultur in den unteren Volksschichten. Dadurch werden die ungleiche Verbreitung und Aufnahme kultureller Produkte in der Gesellschaft offengelegt. Zum anderen werden Situation und Status der in den verschiedenen Zeitabschnitten auftretenden Sub-, Minoritäten- und Gegenkulturen im jeweils vorherrschenden Kulturmilieu beschrieben. Die Verfasser der einzelnen Artikel hatten dabei volle Freiheit, im Rahmen dieser Themenkonstellation ihre eigenen Beobachtungen und Ansichten vorzubringen. Die Periodisierung folgt freilich nicht der Einteilung in Kulturströmungen, sondern richtet sich nach historischen Wendepunkten. Das Mittelalter setzt mit den schwedischen Kreuzzügen nach Finnland ein und endet mit Beginn der Regierungszeit der Herrscher aus dem Wasageschlecht am Anfang des 16. Jahrhunderts. Das Ende der schwedischen Machtperiode 1809 bedeutete die Hinwendung der politischen Kultur nach Osten, zu Russland, was sich auch stark in der Kulturpolitik niederschlug, da zum Beispiel die Hauptstadt des Landes aus dem schwedisch beeinflussten Turku nach Helsinki verlegt wurde. Auf die Unabhängigkeit Finnlands folgte ab 1917 wiederum die Zeit des sogenannten „weißen Finnland“, die zumindest bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges andauerte. Danach begann sich die finnische Kultur zu modernisieren und die Widersprüche zweier Kulturen, der Arbeiterschaft und der „Herrenschicht“, lösten sich mit dem Aufbau des Wohlfahrtsstaates allmählich auf, obwohl die politischen Trennlinien noch bis weit in die 70er Jahre fortbestanden.
Eine Thematik durchzieht gleichsam als roter Faden alle Beiträge: der Begriff der politischen Kultur. Politische Kultur unterliegt der Veränderung und schlägt sich gemeinhin in der Kulturpolitik nieder. Diese beinhaltet die geltenden Ideen, Werte, Normen, Institutionen und Praktiken, mit denen die jeweiligen Machthaber die Gesellschaftsordnung aufrechterhalten und die „Staatskultur“ regulieren. Wie deutsche Kalevala-Kenner (etwa schon Jacob Grimm) feststellten, trat in den vorzeitlichen finnisch-ugrischen Kulturen sowohl „urwüchsige“ physische Machtanwendung als auch äußerst starke verbale Gewalt auf, was sich in der Bewaffnung und allgemeinen Verteidigungsbereitschaft im Finnland der vorhistorischen Zeit ebenfalls nachweisen lässt. Zur Analyse von Wortgebrauch und schriftlichen Kulturprodukten gehört hier auch, die Bedeutung von Kultursymbolen in Konkurrenzsituationen zu erläutern, denn es genügt nicht, Kulturgeschichte als Historie verschiedener Kunstbereiche zu betreiben. Es geht vielmehr darum, die verschiedenen, sogar gegensätzlichen Kulturströmungen in ihrer Geschichte mit- und zueinander zu beschreiben. Auf diese Weise stellen wir die Entwicklung der finnischen Kultur mit all ihren zeitweiligen Herausforderungen und Zurückweisungen in ihrer charakteristischen Gestalt einer peripheren Einheitskultur dar und zeigen auf, wie die Finnen Kultur auf unterschiedlichen Niveaus erfahren haben und wie sie ihre Welt sahen.
Die Wende von den 80er zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts war in Finnland die Zeit eines großen wirtschaftlichen und politischen Umbruchs – und auch kultureller Wandlungen. Die Sowjetunion brach auseinander, der Freundschaftsvertrag verlor seine Bedeutung, man geriet in eine Wirtschaftskrise und die Verbindung nach Europa festigte sich. Man glaubte fest daran, dass die langdauernde Einhelligkeit der Konsensphase, die politische Kultur der „Finnlandisierung“, sich nach außen hin öffnen und neue Werte nach sich ziehen würde. Man vermutete weiter, Finnland würde von nun an empfänglicher auch für fremde Menschen und von diesen übermittelte Kultureinflüsse. Nichts dergleichen trat ein, denn die Anpassung an die Globalisierung und die stramm liberalistische Marktwirtschaft versteiften die Kultur der öffentlichen Diskussion, weil Meinungsverschiedenheiten Finnlands Beziehungen zur Europäischen Union zu bedrohen schienen. Die Diskussion geriet wieder nur zur einseitigen elitären Bevormundung der Bürger. Heute, zur Zeit der Eurokrise und der Unsicherheit über den Weg der europäischen Integration, hat sich die Situation dahingehend gewandelt, dass die bürgerlichen Meinungslager streng gespalten sind in Befürworter der Union und deren Gegner. Die Anhänger befürchten, dass eine Abkopplung Finnlands von Europa und der führenden Rolle Deutschlands auch zu einer kulturellen Entfremdung führen würde; die Gegner wiederum sind der Meinung, die Finnen sollten auf ihre eigenen Kulturwerte vertrauen (Vertrauen in die Berufserfahrung der Lehrerschaft war der Schlüssel für Finnlands PISA-Erfolge), sich ihrer Zähigkeit und Solidarität besinnen und wieder, wie im Winterkrieg, aus eigener Kraft vorwärtsstreben. Die Polarisierung der Bürgerdiskussion spiegelt sich auch in der Kultur: Das Zentrum, also die Hauptstadtregion, vertraut einem internationalisierten, elitären Finnland-Markenzeichen – dafür steht das 200-jährige Helsinki als Welt-Designhauptstadt 2012 mit seinem kostspieligen, spekulativen Werben um ein Guggenheim-Museum. Dem steht das übrige Finnland mit seinen vitalen örtlichen Kulturen gegenüber. Bescheidene Annäherung an fremde Kulturen und deren Rezeption geschieht inmitten dieser oberflächlichen Gärung in Ausbildungs- und Kulturprojekten, in kleineren Gemeinschaften, aber auch in der Unternehmerwelt. So versucht man mancherorts, gemeinsam mit der finnlandschwedischen Minorität nachdrücklich zu beweisen, dass Minderheitskulturen durchaus keine Gefahr, sondern im Gegenteil eine Bereicherung für das Finnentum darstellen. In diesem Sinne überlassen wir das von Lauri Poropudas zum Teil mit eigenen Aufnahmen bebilderte Werk dem kritischen Leser.
Für Unterstützung und Hilfe sind wir folgenden Personen und Institutionen besonders zu Dank verpflichtet:
Prof. Holger Fischer, Universität Hamburg
Mag. phil. Ville Häkkinen
Alfred-Kordelin-Stiftung
Deutsch-Finnische Gesellschaft
Institut für Geschichte und Ethnologie an der Universität Jyväskylä