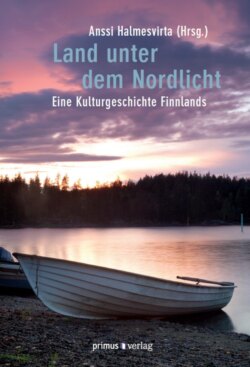Читать книгу Land unter dem Nordlicht - Группа авторов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Multikulti“ auf verschiedenen Ebenen
ОглавлениеDie Angliederung finnischer Gebiete an Schweden und Russland, ebenso wie die Christianisierung und die Verschriftungsbemühungen innerhalb der Gesellschaft, bedeuteten eine Verdichtung der bereits im Gange befindlichen kulturellen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Landesteilen. Die Finnen übernahmen Einflüsse vor allem von den Eroberern, kamen aber direkt oder mittelbar auch mit entfernter wohnenden Völkern und Kulturen in Kontakt. Weil die Kultur ständig im Wandel befindlich und unser Wissen über die frühfinnische Gesellschaft mangelhaft ist, lässt sich schwer sagen, was im Mittelalter letzten Endes ursprünglich finnische Kultur darstellte und was sich daran veränderte. Wie oben bereits geschildert, ist ja nicht einmal eindeutig feststellbar, aus welcher Richtung und zu welcher Zeit neue Einflüsse wie das Christentum angeeignet wurden. In erster Linie lag Finnland im Mittelalter auf alle Fälle im Wirkungsbereich seiner Nachbarvölker, der Schweden und Russen, sowie der übers Meer gesegelten Deutschen. Der dänische Einfluss blieb hingegen kurzzeitig.
Forscher haben versucht, Licht in die Schwedisierung des westfinnischen Verwaltungs- und Rechtswesens zu bringen, aber der Umfang der erhaltenen Dokumente aus der Zeit vor Mitte des 14. Jahrhunderts ist außerordentlich gering. Für die Epoche danach bezeugen Urkunden etwa die Anwendung schwedischer Rechtsprechung; die verabschiedeten Reichsgesetze kamen schnell auch in Finnland in Gebrauch. Das finnische Gesellschaftssystem beruhte nun im Wesentlichen auf den gleichen Prinzipien wie im Kernherrschaftsgebiet westlich des Bottnischen Meerbusens. Die Besteuerungspraxis machte anfangs noch einen Unterschied zwischen dem sogenannten finnischen und dem schwedischen Recht: Im finnischen Recht zahlte man Steuern in Getreide, im schwedischen mit Butter. Man hat dies dahingehend interpretiert, dass das schwedische Recht die weiter entwickelte Viehzuchtgesellschaft und die von den Neusiedlern aus Hälsingland mitgebrachte Praxis widerspiegele. Gegen Ende des Mittelalters beglichen jedenfalls auch die Finnen ihre Steuern durch Butter.
Die große Bedeutung der deutschsprachigen Bevölkerung lag in ganz Skandinavien, und so auch im mittelalterlichen Finnland, auf städtischer Ebene. Finnische Städte wurden im Kern nach deutschem Modell angelegt, was sich schon im Wortschatz zum Stadtleben zeigt: Kaufleute und Handwerker waren vollgültige Stadtbewohner, also porvarit (Bürger, vgl. mittelniederdt. borgere), die Stadt wurde von einem raati (Stadtrat) regiert und die hier behandelten Angelegenheiten wurden in einem sogenannten tänkebok protokolliert (vgl. denkebôk; ein finnisches Äquivalent fehlt, was natürlich bedeutet, dass die Aufzeichnungen in anderen Sprachen notiert wurden).
Der deutsche Einfluss ist auch an den städtischen Bebauungsplänen abzulesen: Die westfinnischen Städte verwirklichten das bekannte Muster der Hansestädte, mit dem Markt als Zentrum für den Warenaustausch oder zur Manifestation der obrigkeitlichen Macht und den daneben oder in unmittelbarer Nähe dazu angesiedelten Symbolen der weltlichen und geistlichen „Regierung“, dem Rathaus und der Kirche. Ein Teil der deutschen Einflüsse erreichte Finnland jedoch indirekt über eingewanderte Schweden. Es ist auch bemerkenswert, dass die Finnen an dem nordischen Terminus kaupunki (Stadt, vgl. altschwed. kaupunger) festhielten, was belegt, dass es hier schon Städte gab oder wenigstens Marktplätze und Siedlungszentren, deren Fortführung die im Mittelalter gegründeten Städte gewissermaßen bildeten.
In den schwedisch beherrschten Gebieten entstanden zwischen 1200 und 1400 sechs offizielle Städte: Turku, Wiborg, Porvoo, Rauma, Ulvila und Naantali. In einigen Fällen lag ein alter Marktort zugrunde, aber die jüngste Stadt, Naantali, war eine Neugründung: Sie entstand als Arbeitskraftreserve und Handelsort mit dem neu errichteten Birgittenkloster. Neben den vom schwedischen Reich anerkannten Städten gab es wichtige stadtähnliche Marktplätze wie Tornio, Hanko und Raasepori, wobei Letzteres oft auch als Stadt bezeichnet wurde. Im orthodoxen Karelien entstand die Stadt Korela neben dem gleichnamigen Kloster und hieß später Käkisalmi. Für die finnischen (und karelischen) Städte war typisch, dass sie an der Meeresküste oder zumindest an einem zum Meer führenden Wasserweg lagen, was sich aus der Art der Verkehrswege und der Möglichkeiten des Warentransports der damaligen Zeit ergab.
Alles in allem blieb die Stadtkultur in Finnland wegen der geringen Anzahl der Städte und ihrer geringen Einwohnerzahlen relativ schwach ausgeprägt. Die größte Stadt war wahrscheinlich Turku mit etwa 1500 bis 2000 Einwohnern zu Beginn des 16. Jahrhunderts; die kleinste war Naantali, das höchstens ein paar Hundert Bewohner zählte. Die mittelalterliche Stadt unterschied sich also in der Größe und auch in ihrer Gestalt nicht unbedingt von einem Dorf. Auch in der Stadt wurden Pferde und Vieh gehalten, Schweine konnten sich auf den Straßen sielen, obwohl man das zu regulieren versuchte, und die Städter hatten ihren Gemüsegarten, entweder am Haus oder am Stadtrand. Auch der Lebensstandard wich kaum vom bäuerlichen ab: Nach archäologischen Funden hatten an der Südküste durchaus auch bäuerliche Anwesen die Mittel, sich aus dem Ausland Luxusgüter wie zum Beispiel Trinkgläser zu leisten. Der schwedische Gelehrte Olaus Magnus berichtet in seiner 1555 erschienenen Pohjoisten kansojen historia (Geschichte der nordischen Völker), dass in der entferntesten Ecke des Bottnischen Meerbusens, auf dem Markt von Tornio, Luxusartikel aus Mittel- und Südeuropa feilgeboten wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Lebensstandard erfolgreicher Bürger, wohlhabender Bauern und kleiner Adliger ungefähr auf dem gleichen Niveau.
Die Städte bildeten wegen ihrer breiter gefächerten Erwerbsstruktur und hinsichtlich ihrer ethnischen Zusammensetzung eine heterogenere Gemeinschaft als die Dörfer. Besonders in Turku und Wiborg lebten Vertreter verschiedener Sprachgruppen; die deutsche Minderheit war in beiden Städten zahlenmäßig und dank ihrer gesellschaftlichen Stellung bedeutend. Die deutschen Bürgerfamilien bevorzugten Eheschließungen innerhalb der eigenen Sprachgruppe – dies war sicher auch dem Bemühen geschuldet, Ehepartner zu finden, deren Familien ähnlich wohlhabend waren wie die eigene. Das Verwandtschaftsgeflecht deutscher Bürger konnte sich über mehrere Städte ausdehnen, was gute Geschäftsverbindungen für die Kaufleute garantierte. Die Hansestadt, mit der die deutschen Bürger eine besonders enge Zusammenarbeit verband, war das nahe gelegene Tallinn, von den Deutschen als Reval bezeichnet, woraus die Finnen dann Rääveli machten. Direkte Verbindungen bestanden aber auch zu entfernteren Orten wie Danzig, Stralsund und Lübeck. Ein Monopolrecht der Deutschen war dies freilich nicht, es konnten auch andere Kaufleute Fernhandel über die Ostsee treiben. Das wohl ausgebildete Handelsnetz fand etwa das Interesse des schwedischsprachigen Erzdiakons von Turku, Paulus Scheel, der sich über seine deutschen Kontakte deutsche Spirituosen und andere Spezialitäten beschaffte.
Das schwedische Stadtrecht erlaubte den deutschen Bürgern, Mitglied des Stadtrates zu werden, und garantierte ihnen dieses Recht sogar bis zur Gesetzesänderung von 1471, als staatspolitische Unruhen und wachsender Ausländerhass sich niederschlugen. Jetzt wurde den Deutschen der Zugang zu allen leitenden Positionen in den Städten verboten. Die Definition hinsichtlich der Zugehörigkeit zu den Nationalitätsgruppen war jedoch fließend: Als Beispiel sei Peter von Aken genannt, der trotz seines deutschsprachigen Hintergrundes in den 1520er Jahren zum Bürgermeister von Turku gewählt wurde.
Die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Gebieten wurden auch dadurch gefördert, dass Menschen aus verschiedenen Dialekt- und Kulturgegenden in die Städte zogen – wenn nicht dauerhaft, so doch, um dort einige Zeit als Knecht oder Magd zu arbeiten. Eine solche Zuzugsbewegung vermittelte Kultureinflüsse in viele Richtungen. Außerdem waren in den Städten verwaltungstechnische und wirtschaftliche Verfahren wirksam, die über die Grenzen der städtischen Gemeinschaft hinaus bis weit in andere Regionen Wirkkraft entfalteten. Die Städte förderten also kulturelle Interaktion zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Gesellschaftsklassen.
Bücher und Schriften vervollkommneten die direkten Kontakte. In der schriftlichen Kommunikation wurden andere Sprachen gegenüber dem Finnischen bevorzugt: in den zu Schweden gehörenden Gebieten Schwedisch, Latein und Mittelniederdeutsch und im russischen Karelien Russisch und Kirchenslawisch. Latein und Kirchenslawisch dienten vorwiegend als von der Kirche verwendete Urkundensprachen, in Latein schrieb man aber bis ins 14. Jahrhundert hinein oft auch weltliche Verwaltungs- und Gerichtsdokumente sowie internationale Korrespondenz. Danach musste das Lateinische in urbanen und auf das Ostseegebiet beschränkten Kontakten dem Schwedischen und Mittelniederdeutschen weichen.
Aus in Nowgorod gefundenen Birkenrindenbriefen ist zu erschließen, dass Karelisch oder irgendeine andere ostseefinnische Sprache in der Laiengesellschaft bis ins 13. Jahrhundert als Schriftsprache benutzt wurde. Im unter schwedische Herrschaft geratenen Finnland hingegen sind entsprechende Quellen nicht aufgefunden worden. Finnisch war in erster Linie Umgangssprache. Insgesamt gesehen wurden im Mittelalter auf der finnischen Halbinsel eine Reihe von Volkssprachen gesprochen, außer Finnisch noch Schwedisch, Deutsch, Russisch, Karelisch, Samisch, Dänisch und Estnisch – oder jedenfalls deren Mundarten. Die höheren Gesellschaftsschichten schwedisierten sich und besonders in Turku und Wiborg waren im wohlhabenderen Bürgertum Schwedisch und Deutsch die üblichen Umgangssprachen.
Turku im Mittelalter
Turku war im Mittelalter die größte Stadt Finnlands mit geschätzten 1500–2000 Einwohnern Anfang des 16. Jhs. Hier eine Ansicht des Künstlers Jaakko Karjula, die auf archäologischen Forschungen beruht (Aboa Vetus et Ars Nova 2005). Noch um 1920 lebten die Einwohner von Finnland teilweise wie auf dem Foto.
Das Finnische wurde allerdings nicht benachteiligt, es war Umgangssprache auch bei Gerichtssitzungen. Das wissen wir daher, dass in Dokumenten mitunter Namen und Ortsbezeichnungen sowie Grenzbeschreibungen auftauchen, die dem finnischen Kasussystem nachempfunden sind. Im Verwaltungsapparat festigte sich schon im 14. Jahrhundert das Prinzip, dass in erster Linie Beamte und Richter berufen wurden, die in Finnland geboren waren, und dass Schreiber auch die finnische Sprache beherrschen mussten. Deutsche Kaufleute schickten ihre Söhne in finnische Städte, damit sie sich die Ortssprache aneignen sollten, wiederum ein Beweis für die Wichtigkeit des Finnischen in der mündlichen Kommunikation. Als Umgangssprache erreichte das Finnische auch anliegende Gebiete, vor allem Schweden, wohin sich manch einer in der Hoffnung auf ein besseres Auskommen begab.
Die frühen finnischen Auswanderer entstammten meistens niedrigeren Gesellschaftsklassen, weshalb der Status des Finnischen in Schweden unbedeutender war als der des Schwedischen in Finnland. Die finnische Sprache war und blieb für die Schweden fremder und schwieriger als das sprachlich näherstehende Mittelniederdeutsche. Die elementare Bedeutung der Sprache kommt auch darin zum Ausdruck, dass in der wichtigsten Stadt des Reiches, Stockholm, nur selten ein Mann aus Finnland eine Stellung im Stadtrat erreichte und wenn doch, dann war es in der Regel jemand, der aus einer schwedischsprachigen oder zweisprachigen Gegend stammte. Die Zugewanderten brachten aber trotz ihres bescheidenen Status Elemente ihrer eigenen Kultur in die schwedische ein, beispielsweise die Erzähltraditionen. Der berühmteste Kirchenkünstler im spätmittelalterlichen Schweden, Albertus Pictor, verewigte im Deckengewölbe der upländischen Kirche zu Härkeberga den Mörder des heiligen Henrik und seine Frau. Vermutlich kam die Anregung dazu von der örtlichen Gemeinde oder von deren Pfarrer, dem die Überlieferung vom Tode des heiligen Bischofs und von den Folgen bekannt gewesen sein muss. Es ist auch denkbar, dass damals in der Gegend verhältnismäßig viele Finnen und deren Nachkommen lebten.
Da die Kirche ihre zentralen Lehren in der Volkssprache und nicht nur auf Latein verkündete und auch die Beamten auf örtlicher Ebene bei Angelegenheiten mit dem gemeinen Volk eine diesem verständliche Sprache benutzten oder wenigstens Dolmetscher einsetzten, hatten die breiten Volksschichten gar kein Interesse an einer finnischen Schriftsprache, sondern sie fügten sich in die sprachlich-kulturelle Vielfalt ein, die für die frühfinnische Gesellschaft charakteristisch geworden war. Schreib- und lesekundige Personen gab es vermutlich ohnehin so wenige, dass es sinnvoll war, bereits vorhandene Schriftsprachen anzuwenden, zumal man diese ohnehin immer dann benötigte, wenn man sich mit anderen als finnischsprachigen Personen schriftlich austauschte.
Das Finnland des Mittelalters war multikulturell und damit eine sehr europäische Gesellschaft. Als der deutsche Gelehrte Sebastian Münster 1544 die erste Auflage seiner Cosmographia veröffentlichte, beschrieb er Finnland als Teil des schwedischen Reiches – und als ein idealeres Land als Schweden. Obschon der Großteil der Bevölkerung sich in einer für europäische Ohren merkwürdigen Sprache äußerte, hatte die finnische Gesellschaft, vor allem in den westfinnischen Küstengebieten, einen Akkulturationsprozess vollzogen, in dessen Verlauf und als dessen Ergebnis sie an der europäischen Zivilisation teilhatte und nicht als außenstehendes, fremdes Element zu betrachten war. Zumindest in den am dichtesten besiedelten Gegenden, an den Küsten also und an den Ufern der aus dem Binnenland strömenden Gewässer, organisierten sich die Strukturen der Kultur nach den im übrigen Europa bekannten Prinzipien. Im Verlaufe von Jahrhunderten eigneten sich die Finnen Formen gemeineuropäischen Gemeinschaftslebens, des Rechtswesens, der Verwaltung und des Handels an und mit diesen eine Reihe diesbezüglicher Termini. Ein ausländischer Reisender, sei es ein Händler, ein auf die Ausschmückung von Kirchen spezialisierter Handwerker oder etwa ein Wallfahrer zum Kloster Naantali, konnte allen Unterschieden zum Trotz bekannte Elemente im mittelalterlichen Finnland erkennen.