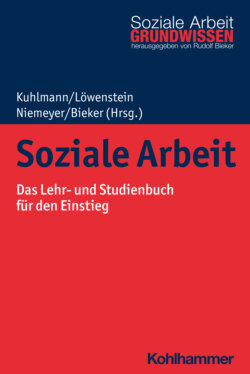Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 72
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Problemzonen sozialer Kontrolle
ОглавлениеDie Kontrollfunktion ist – auch wenn sie dem Mandat der Sozialen Arbeit inhärent ist – mit einer Reihe kritischer Fragen verbunden, die hier nur angerissen werden können.
Wieweit reicht das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung und wieviel Anpassung an allgemeine Verhaltensnormen kann die Gesellschaft von ihren Mitgliedern verlangen? Auf welche Verhaltensnormen bezieht sich Soziale Arbeit, wenn sie sich mit der Lebensführung ihrer Adressat*innen befasst? Gibt es angesichts der Pluralität von Lebensstilen überhaupt Normen, die noch als universal und allgemeinverbindlich vorausgesetzt werden können?
Während Normalität im Alltagsleben nicht hinterfragt wird und wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, »dass normale Handlungsweisen oder Personen von solchen unterschieden werden können, die in irgendeiner Weise außergewöhnlich, unpassend, störend, irritierend usw. sind« (Stehr 2012, S. 225), muss sich professionelles Handeln gerade der möglichen Differenzen in den Vorstellungen von gut und schlecht, falsch und richtig bewusst sein, einschließlich der Macht, die mit der unvermeidlichen Verwendung normativer Etiketten im Alltag der Sozialen Arbeit verbunden ist ( Kap. 1.3). Wer schützt Adressat*innen davor, womöglich den höchstpersönlichen Vorstellungen von Sozialfachkräften über eine »richtige Lebensführung« unterworfen zu werden? Wer hört den sich gegen Eingriffe wehrenden Adressat*innen zu und geht ihren Beschwerden nach?
Die Kontrollfunktion, die historisch in den Handlungsauftrag der Sozialen Arbeit immer schon eingelagert war und auch heute untrennbar mit ihr verbunden ist, erfordert besondere Vorkehrungen gegen Missbrauch und die naive Inanspruchnahme einer machtgeladenen Berufsrolle. Zwar kann Kontrolle auch hilfreich sein (wenn der psychisch Kranke seine Medikamente nimmt, die seine Angstzustände vermindern; wenn Eltern dazu gebracht werden, ihre Kinder zur Schule zu schicken), mit der Formel von der »hilfreichen Kontrolle« (Heiner 2010, S. 109 und 437; Müller 2012, S. 143 zit. n. Lindemann & Lutz 2021, S. 107) lassen sich aber auch weitgehende, nicht begründbare Einschränkungen der Selbstbestimmung von Menschen legitimieren.
Wenn alles ›Hilfe‹ ist und Hilfe ›gut‹ ist, entfällt die Notwendigkeit, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen.
Die Schwierigkeit Sozialer Arbeit, sich auf einem Gelände bewegen zu müssen, bei dem gut und schlecht, richtig und falsch, vertretbar und unvertretbar oft nicht zweifelsfrei feststehen, sondern im jeweiligen Handlungskontext operationalisiert werden müssen, erfordert professionsinterne ethische Leitplanken, an denen sich fallbezogene Entscheidungen in der Praxis ausrichten können ( Kap. 1.5.1). Der Rechtsstaat erfordert, einem Machtmissbrauch vorzubeugen (Beispiele: Heiner 2010, S. 444; Kähler & Zobrist 2017). In der Praxis müssen die Träger sozialer Dienste und Einrichtungen durchgängig kollegiale Beratung und Supervision für ihre Mitarbeiter*innen gewährleisten, nicht erst dann, wenn ein Fall für die Fachkraft zum Problem geworden ist. Die gemeinsame Reflexion hilft ein Übermaß an Kontrollhandlungen zu vermeiden und das Selbstbestimmungsrecht ernst zu nehmen. Unabhängig davon müssen Adressat*innen Sozialer Arbeit die Möglichkeit haben, sich im Konfliktfall an eine unabhängige Ombuds- und Beschwerdestelle zu wenden (s. Heft 1/2020 der Zeitschrift Forum Erziehungshilfen). Dies stärkt nicht nur ihr Selbstbestimmungsrecht, sondern hält auch die Erinnerung bei Fachkräften wach, mit Einschränkungen dieses Rechtes reflektiert umzugehen.