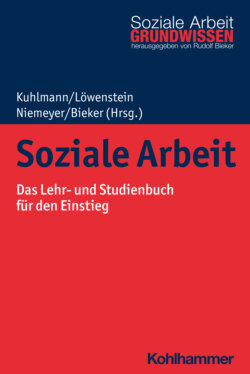Читать книгу Soziale Arbeit - Группа авторов - Страница 75
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5.2 Politische Einmischung
ОглавлениеDas von Staub-Bernasconi (2018) vorgeschlagene dritte Mandat verleiht der Sozialen Arbeit politische Funktionen (vgl. Staub-Bernasconi 2012, S. 277; Lutz 2020). Dass sich Soziale Arbeit aktiv in die Formulierung von (sozial-)politischen Zielen und in ihre Umsetzung einmischen sollte, ist gleichwohl nicht allgemeiner Konsens. Befürchtet wird u. a. eine Bevormundung und Instrumentalisierung der Adressat*innen oder die Enttäuschung falscher Erwartungen an die Politikfähigkeit Sozialer Arbeit (Borstel & Fischer 2018, S. 21; vgl. auch Benz & Rieger 2015, S. 36f.). Für ein politisches Mandat, das sich – gestützt auf Menschenrechte und Verfassungsgebote – in die Sozialpolitik und die Verwirklichung des Rechts- und Sozialstaates einmischt, sprechen aber eine Vielzahl von Gründen:
• Die Soziale Arbeit ist weithin von sozialpolitischen Entscheidungen abhängig, hinter denen ideologische Präferenzen und Weltbilder, Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, begründete oder unbegründete Problemdefinitionen (z. B. »Nicht der Arbeitsmarkt ist das Problem, sondern der Arbeitslose.«) und darauf aufbauende Zielsetzungen stehen (vgl. Borstel & Fischer 2018, S. 13). Die oft konflikthaft getroffenen Entscheidungen haben ebenso wie der Entscheidungsverzicht unmittelbare Auswirkungen auf die Adressat*innen Sozialer Arbeit (Art, Inhalt, Umfang und Ziele von Leistungen, bereitgestellte Ressourcen). Die Entscheidungen bestimmen zugleich den Rahmen, in dem sich Soziale Arbeit bewegen kann bzw. in den sie sich einpassen muss. Hier entscheidet sich z. B. ob Jugendberufshilfe mehr ist als nur das schnelle Fit-Machen von Jugendlichen für Arbeit, welcher Art und Zukunftsfähigkeit auch immer. Politische Entscheidungen greifen aber auch in die fachlichen Berufsvollzüge von Sozialarbeiter*innen ein, z. B. durch Vorgaben zur Hilfeplanung, Qualitätsentwicklung, Dokumentation. Darüber hinaus werden die Arbeitsbedingungen der Sozialfachkräfte durch die Politik und Verwaltung beeinflusst (Entgelt- und Aufstiegsregelungen, Arbeitsgesetze).
• Die Soziale Arbeit verfügt in Praxis und Wissenschaft über ein hohes Maß an Expertise über die Beschaffenheit und die Auswirkungen sozialer Probleme, den Bedarf der Problembetroffenen, die Möglichkeiten der wirksamen und nachhaltigen Problembearbeitung und die Entwicklung innovativer Handlungskonzepte.
• Adressat*innen der Sozialen Arbeit sind sehr häufig von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen (worden), z. B. Bildung, Arbeitsmarkt. Eine politische Partizipation findet praktisch nicht statt. Ihre Interessen und Problemlagen werden – so Rieger (2013, S. 58) – im politischen System nicht oder nicht angemessen berücksichtigt und kommuniziert. Ohnmachtsgefühle, Wahlenthaltung, fehlende Motivation und fehlende Ressourcen zur Interessenartikulation und -durchsetzung auf Seiten der Adressat*innen erfordern nach Rieger (ebd.) einerseits ein advokatorisches »Politikmachen«, andererseits müssen Adressat*innen befähigt werden, ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Es gehe um politische Bildung und die Institutionalisierung von Beteiligungsprozessen. Soweit die Soziale Arbeit allerdings beansprucht, anwaltschaftlich für ihre Adressat*innen aufzutreten, muss berücksichtigt werden, dass Adressat*innen-Interessen nicht homogen sein müssen. Klärungsbedürftig ist, auf welchem Wege diese Interessen ermittelt werden können und wie verhindert werden kann, dass es zu einer unzulässigen Vermischung mit Eigeninteressen der Fachkräfte oder Träger kommt. Hier ist insbesondere die Disziplin Soziale Arbeit (das Wissenschaftssystem) als kritisches Korrektiv gefordert.
• Eine politische Selbstmandatierung ist Ausdruck der Bereitschaft, an der Aufrechterhaltung und Ausgestaltung des sozialstaatlichen Verfassungsgebotes mitzuwirken. Das Primat der demokratisch gewählten Organe, die sozialstaatlichen Gleise zu legen, auf denen die Soziale Arbeit verkehren kann, wird durch Einmischung nicht in Frage gestellt. Einmischung bedeutet, sich auch ungefragt zu Wort zu melden, weil Bedarfe nicht oder nur unzureichend im politischen System aufgegriffen oder mit unzulänglichen Mitteln bearbeitet werden.
Auch wenn das politische Selbstmandat – je nach Reichweite – keine allgemeine Zustimmung findet, so ist die Partizipation an sozialpolitischen Entscheidungsprozessen längst nichts Neues mehr. Die Freie Wohlfahrtspflege hat sich immer schon in der Rolle einer politischen Akteurin gesehen und ihre Möglichkeiten auf allen Ebenen des politischen Systems genutzt (Politikberatung, Anspruch auf Vertretung von Adressat*innen-Interessen, Vertretung von Verbandsinteressen, Grundsatzpositionen zur Gesellschafts- und Sozialpolitik etc.; Bieker & Niemeyer 2022; Vaske 2016). Es ist daher weniger die Frage, ob die Soziale Arbeit für die Ausgestaltung des Sozialstaats Mitverantwortung übernimmt, sondern
• wie sie auf demokratischen Wegen konkrete Positionen formulieren kann,
• wie ein politisches Mitwirkungsmandat verbindlich institutionalisiert werden kann,
• wie die Soziale Arbeit dabei parteipolitisch unabhängig bleiben kann (vgl. auch Schönig 2013, S. 40) und
• wie eine politische Professionalität auszusehen hätte (Benz & Rieger 2015, S. 185ff.).
Grundsätzlich gilt: So wenig wie man nicht nicht kommunizieren kann, so wenig kann man auch nicht unpolitisch sein.
Politisch ist auch der, der nur stumm seine Arbeit tut, was immer man ihm zumutet. Was Sozialfachkräfte an der Basis sozialpolitisch tun können, hat Heiner (2010, S. 480ff.) schon vor Jahren nachlesenswert beschrieben.