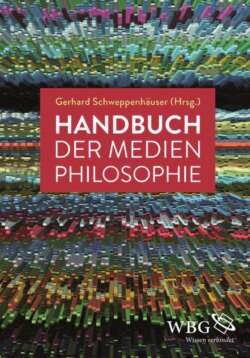Читать книгу Handbuch der Medienphilosophie - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Zur Geschichte von Medientheorien 2.1 Kurze Geschichte des Metaxy
ОглавлениеGleichwohl kann, gegen diese Vergessenheit, die philosophische Verwendung des Begriffs schon früh nachgewiesen werden. Bezeugt spätestens seit den scholastischen Kommentaren zu den Schriften des Aristoteles, geht er einerseits auf dessen Syllogismuslehre zurück, deren Zwischenglied einer Beweiskette in den mittelalterlichen Logiken als medius terminus bezeichnet wurde, welcher den Schluss erzwingt, um in dessen Vollzug unterzugehen (Bahr 1999). Andererseits übersetzte Thomas von Aquin die Präposition metaxy aus der Aisthesislehre des Aristoteles (1995: 418 aff.) mit „Medium“ und leitete damit eine Tradition ein, die über die neuzeitliche Naturphilosophie bis ins frühe 20. Jh. reichen sollte (Hoffmann 2006). Denn nach Aristoteles muss sich das Wahrgenommene vermittels eines anderen dem Wahrnehmenden allererst mitteilen, wofür er unter Rückgriff auf ältere Wahrnehmungslehren den Ausdruck des diaphanen oder „Durchscheinenden“ einsetzte. Es ist ein ‚Dazwischenliegendes‘ (metaxy), das sich Aristoteles zugleich als stoffliche Substanz vorstellte (Alloa 2011). Die gesamte spätere Problematik des Medienbegriffs ist darin vorgeprägt: Ohne Medium sieht man nichts, wie umgekehrt das Medium selbst unsichtbar bleibt, das als transparenter Stoff, der sich von Licht unterscheidet, lediglich indirekt, d.h. durch „Trübung“ hervorzutreten vermag. Zugleich verändert diese mediale Stofflichkeit das durch es ‚Hindurchscheinende‘, sodass wir nicht nur vermittelst eines Mediums sehen, sondern auch durch (dia/per) es: Das Medium erzeugt eine Sichtbarkeit. Sehen erweist sich dann unmittelbar an es gebunden und durch es produziert wie modifiziert.
Eine ähnliche Bewegung lässt sich auch in Ansehung der zweiten Quelle, die gewöhnlich genannt wird, nachweisen: Platons Schrifttheorie. Im Dialog Phaidros beschreibt Plato (1998: 274 d, 275 a) die Schrift als eine ‚Kunstfertigkeit‘ (techne), die ihre eigenen Folgen nicht abzuschätzen vermag, denn sie diene nicht nur der Aufzeichnung und dem Gedächtnis, sondern schaffe auch „Vergessenheit“. Insbesondere aber bleibe ihr Verhältnis zur Wahrheit prekär, denn die Wahrheit erfordere den lebendigen Dialog. Als Medium erscheint deshalb die Schrift zutiefst ambivalent; dabei lautet das entscheidende Wort, auf das auch Jacques Derrida (1995: 73ff., 84ff.) seine Platon-Deutung stützte, pharmakōn, das sowohl als Gift als auch als Heilmittel begriffen werden muss. Erneut zeigt sich eine indifferente Mitte, auf die Platon in verschiedenen Dialogen zu sprechen gekommen ist, z.T. sogar mithilfe derselben Präposition metaxy (Voegelin 2005: 267ff.), so etwa im Symposion in Gestalt des Daimonions Eros, der weder den Sterblichen noch den Unsterblichen angehört, sondern blitzartig und ohne Grund Beziehungen knüpft. Darüber hinaus wird im Timaios auf ähnliche Weise die chōra als ein ‚dritter‘ Raum bezeichnet, der weder Form noch Stoff ist, sondern das ‚Gebärende‘ oder Öffnende, das beide allererst zulässt.
Offenbar scheint zur Zeit der Grundlegung der europäischen Metaphysik bereits klar, dass die Binarität der Begriffe, die sämtliche Grundworte wie Sein, Wahrheit, Grund oder Begriff usw. bestimmt, keineswegs ausreicht, um die Phänomene angemessen zu fassen. Immer schon ‚arbeitet‘ ein Anderes, eine Heterogenität ‚mit‘, die aus den Dualismen systematisch ausfällt, um zwischen den Oppositionen die Funktion einer ‚Mediation‘ einzunehmen. Es treibt, ohne expliziert zu werden, in die orthodoxen philosophischen Reflexionen einen Keil, der nicht aufhört, sie unablässig durcheinanderzubringen (diabolon). Als ‚Unwesen‘ (diabolos) unter Verdacht gestellt, wird das Medium vielmehr ausgetrieben und durch die Eindeutigkeit logischer Gegensätze ersetzt. Mit Fug und Recht gleicht es so einem ‚diabolischen‘ Prinzip, das stets dort auftaucht, wo nicht mit ihm gerechnet wird, und, wo es gestellt wird, sogleich entwischt – ein „Geist, der stets verneint“ und doch, wie es treffend in Johann Wolfgang Goethes (1998: V. 1336–1337; 1338–1340) Faust heißt, „Teil von jener Kraft,/Die stets das Böse will und stets das Gute schafft“.